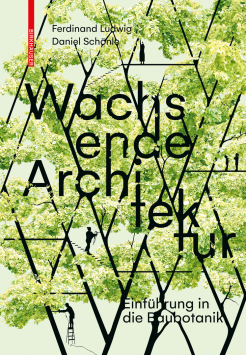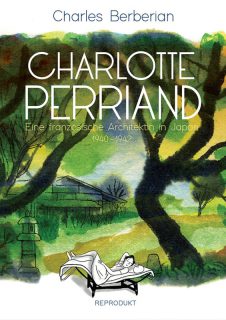Wachsende Architektur
Baubotanik beschreibt eine Bauweise, bei der Bauwerke durch ein Zusammenspiel von pflanzlichem Wachstum und technischen Konstruktionen entstehen. Professor Ferdinand Ludwig von der TU München liefert in seiner jüngsten Publikation „Wachsende Architektur – Einführung in die Baubotanik", die in Zusammenarbeit mit seinem Büropartner Daniel Schönle aus dem Office for Living Architecture (OLA) entstand, umfangreiche Praxisbeispiele und Forschungserkenntnisse aus dem Themengebiet.
Unsere Städte müssen klimaneutraler werden, das Bauen orientiert sich zunehmend an
Suffizienz-Strategien, zudem soll alles effizient sein. Doch allein durch die Verwendung neuer Begriffe kann man die angestrebte Bauwende nicht erreichen. Die sich abzeichnende Trendwende hin zu
natürlichen nachwachsenden Baustoffen ist schon eher dazu geeignet, das Leben in Städten und Gebäuden angenehmer, sozial verträglicher und klimaschonender werden zu lassen. Das Ziel sollte sein, dass
Bauen dem Klima nützt und nicht „nur“ weniger schadet.
Die Baubotanik kann hierzu beitragen. Auch wenn sie nicht die generelle Lösung darstellt, so bietet sie zu mindestens einen interessanten und spannender Ansatz. Dabei geht die Baubotanik einen
Schritt weiter als die Verwendung schnell nachwachsender Materialien wie Stroh und Gräser. Auch wenn das Verfahren sicherlich nur für spezielle Bauaufgaben einsetzbar ist, allein die Idee ist bereits
faszinierend.
Große Beispiele kommen aus der Vernacular Architecture, also den traditionellen einheimischen Bauarten. In Indien sind das die lebenden Brücken aus den Luft-Wurzeln der tropischen Bergwälder. Fast in
Vergessenheit geraten ist dagegen die gewachsene Architektur der Tanzlinden in Mitteleuropa.
"Wachsende Architektur" von Ferdinand Ludwig und Daniel Schönle ist ein faszinierendes Buch,
das sich mit der Idee beschäftigt, Architektur als lebendiges und sich entwickelndes System zu betrachten. Der Autor zeigt auf, wie sich diese lebende Architektur im Laufe der Zeit verändert und wie
man das Wachstum in die Planung integrieren kann. Schlussendlich werden auch Perspektiven aufgezeigt, wie sie sich die Baubotanik in Zukunft weiterentwickeln könnte. Dabei wird auf verschiedene
Aspekte eingegangen, wie zum Beispiel die Verwendung von nachhaltigen Materialien oder die Integration von Technologie in Gebäudestrukturen aussehen kann.
Die Einführung in die Baubotanik ist sehr gut strukturiert und enthält viele anschauliche Bilder und Grafiken, die die Konzepte noch besser veranschaulichen. Insgesamt ist es sehr anschaulich und
verständlich geschrieben, so dass auch Laien ohne Probleme sich in diese Bauform eindenken können.
Insgesamt ist "Wachsende Architektur" jedem zu empfehlen, der sich für Architektur und Design interessiert und sich gerne mit neuen Ideen und Konzepten auseinandersetzt. Das Buch ist eine
inspirierende Lektüre, die zum Nachdenken anregt und neue Perspektiven auf das Thema Architektur eröffnet.
BDB-Nachrichten 4/2023
Baustoff mit »Selbstheilungskräften«
Römischer Beton ist unverwüstlich: Auch nach ca. 1900 Jahren beeindruckt die riesige Kuppel des Pantheons und selbst 2000 Jahre alte antike Hafenanlagen erweisen sich als haltbarer als moderne Betonmolen. Wie es den Römern gelang, einen Baustoff herzustellen, der sich selbst repariert, gab der Wissenschaft lange Rätsel auf. Doch nun haben Forscher einen weiteren Teil seiner Geheimnisse enthüllt.
Während hierzulande Autobahnen an »Betonkrebs« leiden und Brücken zerbröseln, waren die Baumeister im antiken Rom
bereits wesentlich weiter: Sie verfügten über unterschiedliche spezielle Rezepturen, mit denen sie ressourcenschonend Beton produzierten, der den modernen »Portlandbeton« qualitativ in den Schatten
stellt.
Deshalb versuchen Wissenschaftler seit Jahrzehnten, dem verlorengegangenen Wissen um »opus caementitium« (so die Bezeichnung des römischen Betons) auf die Spur zu kommen, um es für heutige Bauwerke
nutzbar zu machen.
Nun ist ein Forscherteam um Linda Seymour und Admir Masic vom MIT in Boston in Zusammenarbeit mit italienischen
Wissenschaftlern der Entschlüsselung des Rätsels einen weiteren Schritt nähergekommen, wie ihr im Januar 2023 veröffentlichter Forschungsbericht belegt.
Bereits vor wenigen Jahren hatten andere Forschungen offengelegt, dass der römische Beton Vulkanasche als Zusatzstoff benutzte, die ihm eine enorme Stabilität und Dauerhaftigkeit verlieh. Besonders
verblüffend war dabei die Entdeckung, dass der Beton damit für die Verwendung für Hafenanlagen, Molen und Wasserleitungen prädestiniert zu sein schien – alles Einsatzbereiche, bei denen moderner
Beton noch schneller schlappmacht als auf dem Trockenen. Als »Clou« an der Verwendung von Vulkanasche erweisen sich darin enthaltene seltenen Stoffe, »Puzzolane« genannt, und deren Reaktion mit
Meerwasser. Anstatt den Beton zu schwächen, löst der Kontakt mit Wasser eine chemische Reaktion aus, die ihn wesentlich langlebiger und resistenter gegenüber Wasser machen.
So setzten also die Römer bewusst genau das als Produktionsmethode ein, was die heutige Betonherstellung auf jeden Fall vermeiden möchte: Chemische Reaktionen, die innerhalb des verbauten Betons
ablaufen.
Allerdings blieben die genaue Rezeptur des »Wunderbetons« und seine Wirkweise immer noch ungeklärt. Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen nun, dass Puzzolane nicht die einzige besondere
Zutat der Römer bei der Betonherstellung waren. Hatte man bis dato vermutet, dass milimetergroße Einschlüsse in Form von weißen Kalkbröckchen, die man im Beton fand, bloße Verunreinigungen
darstellten, sah sich das MIT-Team diese genauer an. Es schien nicht schlüssig, dass die Römer einerseits oben beschriebene technische Kniffe bei der Produktion anwendeten, aber gleichzeitig so
nachlässig arbeiteten, dass ungewollt grobe Verunreinigungen entstehen konnten.
Mit Hilfe des Elektronmikroskops und modernster Labormethoden untersuchte man daraufhin Proben aus der rund 2000 Jahre alten Stadtmauer des antiken Pivernum. Dabei gewann man die Erkenntnis, dass
gerade diese »Bröckchen« enorm zur Wasserfestigkeit des Materials beitragen. Denn die Römer verwendeten zwar normalerweise gelöschten Kalk zur Produktion ihres »opus caementitium«.
Allerdings gab es auch die noch wesentlich effektivere Variante, diesen durch trockenen Branntkalk zu ersetzen. Auf diesem Wege konnten sie bei geringer Temperatur eine exothermische Reaktion
freisetzen, die sonst nur unter extremer Hitze stattfindet, und so die Bröckchen erzeugen. Falls dann später Poren oder Risse entstehen und Wasser in den Beton eindringt, löst sich Kalzium aus ihnen,
sodass Kalziumkarbonat entsteht. Dieses wiederum tritt in eine Reaktion mit der Vulkanasche: Die Lücken im Beton werden so wieder geschlossen, das Material heilt sich selbst.
Um das Ganze im Labor zu erproben, stellten die Forscher auf Basis dieser Erkenntnisse unterschiedliche Betonmischungen her. Den produzierten Beton spaltete man und fügte ihn danach so zusammen, dass
ein Spalt von 0,5 mm verblieb. Nachdem man kontinuierlich Wasser darüber laufen ließ, war das Ergebnis wie vermutet: Während das Wasser durch den Beton ohne Einschlüsse nach 30 Tagen ungehindert
weiterfloß, hatte sich der Spalt in dem Beton mit »Bröckchen« fast komplett geschlossen: Der ungelöschte Kalk hatte sich in Verbindung mit dem Wasser in gelöschten Kalk umgewandelt, der
mineralisierte und damit den Spalt wieder auffüllte.
Nun setzen die Forscher alles daran, die alte Rezeptur bis ins kleinste Detail zu entschlüsseln, um sie auch heutzutage nutzbar zu machen. Schließlich ist der
moderne »Portlandbeton« nur auf eine Lebensdauer von 50 bis 150 Jahren ausgelegt und erreicht diese oft nicht einmal annähernd. Eine längere Haltbarkeit, weniger Reparaturanfälligkeit und ebensolche
Selbstheilungskräfte stünden natürlich auch modernen Bauwerken gut zu Gesicht, zumal andere innovative Selbstheilungstechniken, wie z.B. durch Bakterien, teuer sind – und natürlich nicht solange
erprobt wie die römische Methode.
Wenn man Zement und Beton auch bei geringeren Temperaturen herstellen könnte, wäre dies ein Beitrag, um die CO2-Emissionen zu senken, an denen die Zementproduktion mit 8 % beteiligt ist. Außerdem
wäre es angesichts von 19 Mrd. Tonnen Beton, die jährlich weltweit verbaut werden, ökonomisch und ökologisch von enormem Vorteil, wenn diese ebenso haltbar sein könnten wie antike Wasserleitungen,
die teilweise heute noch ganz selbstverständlich ihren Beitrag zum Wasserversorgung italienischer Städte leisten.
Neues Deutschland 2023
Nachhaltige Alpenarchitektur
Das Bauen in den Alpen ist seit jeher eine besondere Herausforderung: Unwegsames Gelände und extreme
Witterungsbedingungen stellen spezifische Anforderungen an Baumaterial und Konstruktionsweise. Demzufolge hat sich über Jahrhunderte hinweg eine traditionelle alpine Architektur entwickelt, für die
die Verwendung regionaler Baustoffe wie Holz und Granit, aber auch architektonischer Elemente wie etwa steile Satteldächer, kleine Fensteröffnungen und große Dachüberstände charakteristisch sind.
Auch heute noch ist das Bauen in den Alpen eine Gratwanderung, wenn man die regionale Bauweise in eine moderne Architektursprache übersetzen will, die zugleich ästhetisch und nachhaltig ist.
Beispielhafte Projekte, wie das gelingen kann, präsentiert das Buch „Bauen in den Alpen“. Der schön gestaltete Titel ist 2021 in der Edition Hochparterre erschienen und zieht auf gut 200 Seiten eine
Bilanz aus 10 Jahren Architekturpreis „Constructive Alps“, dem Wettbewerb zum klimavernünftigen Bauen und Sanieren in den Alpen.
Eine sechsköpfige internationale Jury zeichnet bei dem Wettbewerb Bauobjekte und Sanierungen aus, die in vorbildlicher Weise
für eine nachhaltige Architektur in den Alpen stehen. Der Preis wird seit 2011 gemeinsam vom Schweizer Bundesamt für Raumentwicklung ARE und dem Fürstentum Liechtenstein verliehen. Am Anfang standen
allein Energieeffizienz und umweltschonende Baumaterialien im Vordergrund. Da ein nachhaltiges Gebäude aber mehr leisten muss, hat sich „Constructive Alps“ weiterer Themen angenommen, so etwa der
Frage, wie ein Bau den Außenraum prägt oder wie ein Gebäude das baukulturelle Erbe in der Region weiterentwickelt.
Bei den im Buch vorgestellten Bauwerken handelt es sich sowohl um Sanierungen als auch um Neubauten; Einzelhäuser wie auch Gebäudeensembles sind vertreten. Dabei finden sich unterschiedlichste
Gebäudetypen und -nutzungen, wie beispielsweise die Erweiterung eines Forstwerkhofes in Liechtenstein, ein in dörflicher Gemeinschaftsarbeit entstandenes Stadion in Schluein, ein Seniorenwohnheim im
oberbayerischen Schechen oder auch ein Holzhochhaus in Grenoble.
Von einer beispielhaften „Wiederbelebung“ dörflicher Strukturen zeugt die Renaissance des Dorfes Valendas im Kanton Graubünden. Hier wurde Schritt für Schritt alte Bausubstanz zu neuem Leben erweckt
und um eine neue Siedlung ergänzt. Auch die renovierte Mitte des Dorfes Krumbach in Vorarlberg, bei dem die Gemeinde die Zersiedelung stoppte und neben anderem ein neues Gemeindehaus und Pfarrhaus
erbaute, zeugt davon wie man Leben in einstige „Schlafdörfer“ bringen kann.
Alle Bauwerke werden mittels Texten, Bildern und
Plänen vorgestellt. Abgerundet und ergänzt werden diese durch Essays von Gion A. Caminada, Paolo Cognetti, Köbi Gantenbein, Asa S. Hendry, Benjamin Quaderer und Uroš Zupan.
Köbi Gantenbein (Hg.): Bauen in den Alpen, Edition Hochparterre 2021, 202 Seiten
978-3-909928-65-1
www.constructivealps.net
BDB Nachrichten NRW 4/2021
Eine Avantgardistin in Japan:
Charlotte Perriand
Eine
Architektin als Mittelpunkt einer Graphic Novel, das findet man nicht oft. Umso erfreulicher ist es, dass der Reprodukt Verlag 2020 eine sehr informative Comic-Biographie über Charlotte Perriand
veröffentlicht hat.
Charlotte Perriand (1903-1999) war eine Avantgardistin ersten Ranges: Architektin, Möbeldesignerin und Fotografin in einer Person. Dennoch ist sie heutzutage außerhalb von Fachkreisen nur noch
wenigen bekannt.
Dabei hatte sie bereits 24jährig mit ihrer in Kupfer und Aluminium gehaltenen Bar sous le toit („Bar unterm Dach“) im Jahr 1927 auf der Ausstellung Salon d’Automne für Furore gesorgt. Das stellte für sie der Beginn ihrer Arbeit im Pariser Atelier von Le
Corbusier in der Rue de Sèvres dar, wo sie für die meisten der dort entworfenen Möbeldesigns
verantwortlich zeichnete. Allerdings wurden einige ihrer bekanntesten Möbel Le Corbusier zugeschrieben, so etwa der Freischwinger Fauteuil pivotant und der Chaise longue basculante. Zehn Jahre lang profitierte Le Corbusier so vom Esprit
und der Schaffenskraft Perriands in seinem Büro, bis sie als Beraterin für Industriedesign vom dortigen Handelsminister ins kaiserliche Japan eingeladen wurde.
Der Comic von Charles Berberian begleitet die Architektin auf ihre zweijährige Reise ab Juni 1940, die zum Meilenstein in ihrer Karriere wurde. Obwohl ihr viele Politiker in Japan mit großer Skepsis
begegneten, entwickelte sich der Aufenthalt für Perriand zu einem großen Erfolg. Sie tauchte tief in die Kultur und Tradition des Landes ein, was zu einer immensen Inspirationsquelle für ihre
Entwürfe wurde. Auf dieser Basis entwickelte sie eine einzigartige Vision von Innenarchitektur, sodass bis heute nicht nur in Japan einige ihrer Möbel, wie etwa ihre Chaises longues (Stühle
aus Bambus) oder der Ombre chair (ein niedriger Hocker aus Holz) Klassiker geblieben sind.
Leichtfüßig und elegant erzählt Berberian in liebevoll gestalteten Aquarellen diese Schlüsselmomente ihres Schaffens nach, wobei ihre Probleme in einer Männerdomäne und beim Kriegseintritt Japans ein
wenig knapp dargestellt werden. Leider endet die Graphic Novel auch etwas abrupt bereits nach 55 Seiten mit dieser Episode ihres Lebens. Da hätte man gerne noch ein wenig weiter geschaut und gelesen…
Allerdings tröstet ein sehr ausführliches Gespräch mit ihrer Tochter, Pernette Perriand, über den kurzen Einblick in ihr Leben hinweg, zumal Pernette Perriand uns einen sehr persönlichen Blick auf
das Leben und Schaffen dieser ebenso kreativen wie starken Persönlichkeit vermittelt.
Charles Berberian: Charlotte Perriand – Eine französische Architektin in Japan 1940-1942, Reprodukt 2020, 112 S., ISBN 978-3-95640-234-0, 20 EUR
BDB Nachrichten 12/2020
Habitat. Regionale Bauweisen und Globale klimazonen
Der Zweck eines Hauses ist es, seine Bewohner vor
den negativen Einflüssen der Umwelt zu schützen. Abhängig davon, wo man lebt und die Behausung baut, kann das Hitze, Kälte, Nässe oder Wind sein. Doch nicht nur die Wetterbedingungen, vor denen man
Schutz suchte, sondern auch das in der näheren Umgebung vorhandene Baumaterial prägten in vorindustriellen Zeiten die regionale Architektur, wie die Verwendung von Torf, Lehm, Stein, Holz,
Palmblättern oder gar Schnee belegen. So entstand eine ungeheure Vielzahl von unterschiedlichen Hausformen, die zwar alle die gleichen Grundbedürfnisse ihrer Bewohner befriedigen, dies aber angepasst
an die jeweiligen geologischen und klimatischen Bedingungen tun.
Der voluminöse und einige Kilogramm schwere Sammelband „Habitat“, herausgegeben von Sandra Piesik, präsentiert auf 600 Seiten und mehr als 1000 Abbildungen die eindrucksvolle Varietät
vieler fast schon vergessener Kenntnisse und Methoden, sich beim Bauen dem örtlichen Klima und den vorhandenen Ressourcen anzupassen, anstatt sie zu ignorieren.
Dabei wurden die vorgestellten Bauten nicht nach
Kontinenten, sondern nach den 5 Klimazonen geordnet, das Spektrum reicht vom sogenannten Oca, einem Haus mit Grasdecke bis zum Boden im tropischen Amazonasgebiet bis hin zur oder der isländischen
Torfarchitektur in polaren Regionen.
So finden sich kontinentübergreifend sehr ähnliche Antworten auf ähnliche klimatische Bedingungen, denn traditionelle Baumeister wussten z.B. um den Wert großer Dachüberstände in schneereichen
Regionen wie den Alpen oder dem Himalaja. Und wer gar kein Material hatte, außer Schnee, setzte diesen kundig als halbkugelförmigen Iglu, also der kleinsten Oberfläche bei gegebenem Rauminhalt und
damit dem geometrisch geringstmöglichen Wärmeverlust, als Behausung ein.
Zahlreiche Beispiele, die erstaunen und
beeindrucken, sind hier versammelt, so etwa die Rundbauten der Hakka in Südchina, unter deren Satteldächern im Innern ganze Dörfer Platz haben und sich nach außen wehrhaft präsentieren. Aber auch
Baumhäuser in Papua-Neuguinea, Windtürme aus arabischen Ländern, Bambushäuser aus Vietnam und papierne Architektur aus Japan finden hier ihren Platz.
Die Beispiele traditioneller Baukunst aus 80 Ländern werden ergänzt von anschaulichen Texten von 140 Fachautoren, die die jeweilige Architektur und ihre Entwicklung erläutern.
Vorangestellt ist den Kapiteln mit den Beispielen
aus 5 Klimazonen (Tropisch, Trocken, Gemäßigt, Kontinental, Polar) ein Vorwort von Tomasz Chruszcszow und eine Einleitung der Herausgeberin. Ihnen folgen fünf einleitende Essays: Einfluss des Klimas,
geologische Klassifikation, Pflanzen in der gebauten Umwelt, Eine anthropologische Einführung, Der Wert des Traditionellen.
Abgeschlossen wird das Werk von drei Anhängen zu den Themen Ursprüngliche Bauweisen heute, Naturkatastrophen, Einführung in die Werkstoffwissenschaft.
Insgesamt ist das Buch nicht nur eine interessante
Reise durch die Architekturen der Welt, sondern vermittelt dabei auch wichtige Impulse, um über die Analyse bewährter Systeme und der Rückbesinnung auf Erkenntnisse des traditionellen Bauens zu einer
nachhaltigen Architektur der Zukunft zu gelangen.
Veröffentlicht auf www.baunetzwissen.de, Rubrik geneigtes Dach:
www.baunetzwissen.de/geneigtes-dach/tipps/fachbuecher/habitat-regionale-bauweisen-und-globale-klimazonen-5288103
Archiflop: Ganz schön scheußlich
Viele von uns besuchen gerne Ruinen wie das Kolosseum, die Akropolis oder das antike
Olympia. Denen ist in der Regel eines gemeinsam: Als man diese Bauten schuf, nutzte und schätzte man sie, bis sie irgendwann dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen. Doch nun widmet sich ein neuer
Bildband über moderne Bauruinen ganz dem architektonischen Scheitern.
Moderne Trümmer haben in der Regel nichts vom Charme vergangenen Glanzes, im Gegenteil. Kaum genutzt und gleich verlassen,
oder schlimmer noch: überhaupt nie vollendet – das sind die Schicksale, die hinter vielen Gebäuden stehen, die vor sich hin bröseln, bis sie abgerissen oder von der Natur zurückerobert werden. Meist
ignorieren wir einfach den unsäglichen Schrott, der da herumsteht, nicht so aber Alessandro Biamonti, Architekt und Design-Dozent aus Mailand. Er hat die misslungensten Scheußlichkeiten der jüngeren
Architekturgeschichte ausfindig gemacht und stellte 25 spektakuläre Beispiele aus aller Welt für einen Bildband beim DVA Verlag zusammen.
Dabei geht es ihm nicht um Häme und Schadenfreude angesichts der Misserfolge seiner KollegInnen. Vielmehr möchte er einen neuen Blickwinkel auf die gefloppten Bauten eröffnen, sie quasi als Denkmäler
des Scheiterns verstanden wissen. Auf diese Weise könnten sie vielleicht dafür sorgen, dass man in Zukunft vor eklatanten Fehlplanungen, unguten Entscheidungen und mangelndem Realitätsbezug eher
gefeit ist als bisher. Denn schließlich sind sie nicht nur für Bauherren ein finanzielles Desaster und für Architekten ein Schandfleck auf der Vita – sondern vor allem ein Problem für die
Menschen, die darin leben, arbeiten oder sich gar vergnügen sollen.
Da ist zum Beispiel Paris, oder zumindest eine Mini-Kopie davon in China. Die Retortenstadt
Tianducheng plante man für 10.000 Menschen, doch auch nach Jahren wohnen nur etwa 2.000 Personen dort. Zu teure Mieten, zu abgelegen – allein die Hochzeitstouristen, die sich gerne vor dem Eiffelturm
oder auf der Champs Élysées fotografieren lassen, sorgen für ein wenig Leben in der Geisterstadt. Ähnlich Potemkinsche Züge trägt der Bau des Ryugyong-Hotels im nordkoreanischen
Pjöngjang. Die 330 m hohe Bauruine wurde in den 1980er Jahren als ehrgeiziges Projekt begonnen, aber nie vollendet – Schließlich hübschte man 2008 den Rohbau mit einer Glasfassade auf, um das Debakel
zu verbergen. Dennoch war selbst den nordkoreanischen Machthabern das Dokument ihres Größenwahns so peinlich, dass es inzwischen im Stadtplan einfach gestrichen wurde.
Einfach verschwinden lassen kann man Bauten aber natürlich nicht. Aber wenn man der Natur
lange genug Zeit lässt, erledigt sie das von alleine: So etwa bei der Metrolinie Chatelet in Charlesroi in Belgien, deren 6.8 km lange Strecke nie in Betrieb ging, aber über vier teilfertige
und 4 fertige Stationen verfügt und die nun seit 30 Jahren mehr und mehr verfällt.
Lakonisch und informativ erzählt, zudem fotografisch gut in Szene gesetzt, ist ein toller Bildband gelungen, bei dem auch die inhaltliche Einführung und die gut durchdachte thematische Einteilung des Buches überzeugen. Ein weitere Stärke Biamontis liegt darin, dass er nicht nur zeigt, was es alles ans Schrecklichkeiten gibt, sondern auch Ansätze zeigt, wie man aus Problemen Chancen macht – und so die Ungetüme vielleicht doch noch einen Nutzen haben.
Alessandro Biamonti: Archiflop. Gescheiterte Visionen. Die
spektakulärsten Ruinen der modernen Architektur (Ü: Ulrike Stopfel), DVA 2017, 192 S.; 29,95 Euro
Veröffentlicht in: Junge Welt 2017
Architektur der Zuflucht
Bei einer großen Anzahl schutzsuchender Menschen, die dringend ein Dach über dem Kopf
brauchen, ist schnelles Handeln gefragt. So blieb 2015, als ca. 890 000 Flüchtlinge, vor allem aus Syrien, in die Bundesrepublik kamen, für strategisches Handeln keine Zeit. Doch mittlerweile ist
klar, dass man Aktionismus durch staatliche Programme ersetzen muss, um den Geflüchteten dauerhaft eine menschenwürdige Unterkunft zu geben. Vor allem in den Ballungsräumen machte dies das ohnehin
bestehende Problem der Wohnungsknappheit deutlich sichtbar. Lange Zeit ignoriert, sind Lösungen dringend notwendig: bezahlbarer Wohnraum für alle! Aber wie schafft man das?
Antworten darauf liefert dieses Handbuch, das zur Versachlichung der Flüchtlingsdebatte
beitragen und zugleich positive Impulse für den Wohnungsbau setzen will. Die Publikation fordert unkonventionelle Ideen, Innovationswillen und Pragmatismus bei Neubau, Umnutzung und Sanierung. Das
Credo der Autoren lautet: Brauchbarer und dauerhaft guter Wohnungsbau muss nicht neu erfunden werden - man muss lediglich vorhandenes Wissen und Erfahrungen bündeln und umsetzen.
In erster Linie wendet sich das Handbuch an Architekten, Projektentwickler sowie Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung, die sich mit dem Bau und Betrieb von Unterkünften für Flüchtlinge auseinandersetzen. Gleichwohl ist die Lektüre aber auch städtebaulich bzw. gesellschaftspolitisch interessierten Laien zu empfehlen. Geschichtliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge werden darin ebenso kundig erläutert, wie erprobte und innovative Gebäudeformen vorgestellt. Ergänzt wird das Ganze durch Beispiele aus Flüchtlingsprojekten sowie aus dem sozialen Wohnungsbau oder der Bestandsanierung. Besonders positiv sticht hervor, dass hier nicht nur Architekten, Stadtplaner, Juristen, Soziologen zu Wort kommen, sondern auch Flüchtlinge selbst mit Beiträgen vertreten sind.
Es bleibt zu hoffen, dass viele Entscheider in der Politik, aber insbesondere auch in den kommunalen Baubehörden angeregt werden, neue Wege zum Nutzen und Wohle aller, der Alt- und Neubürger der Bundesrepublik zu gehen.
Lore Mühlbauer/Yasser Shretah (Hg.): Flüchtlingsbauten. Architektur der Zuflucht:
Von der Notunterkunft zum kostengünstigen sozialen Wohnungsbau. DOM Publishers. 304 S., geb, 78 €.
Neues Deutschland 18.08.2017
<< Neues Bild mit Text >>
Keine Einheitsplatte
Philipp Meuser zeichnet ein neues Bild vom industriellen Wohnungsbau der UdSSR
Das Buch ist eine Wucht! Und das bezieht sich nicht nur auf sein Format oder sein Gewicht. Immerhin misst es stolze 235 mal 275 mm und wiegt fast drei Kilo. Wir haben es mit einem echten Schmuckstück zu tun – innen wie außen. Entfernt man den Schutzumschlag aus starkem Karton, entpuppt sich dieser als Plakat mit dem Motiv eines Wandmosaiks. Und darunter kommt ein roter Einband mit Goldlettern zum Vorschein. Ebenso opulent geht es im Innern des Buches weiter: Mehr als 1.400 kundig zusammengestellte Abbildungen in bester Grafik zeugen von ebensoviel Fleiß wie Sachkenntnis des Autors von »Die Ästhetik der Platte. Wohnungsbau in der Sowjetunion zwischen Stalin und Glasnost«. Der Berliner Architekt Philipp Meuser hat für seine Studie zahlreiche bisher unveröffentlichte Foto- und Textdokumente in Archiven auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR aufgespürt.
Er widmet sich dem industriell vorgefertigten seriellen Wohnungsbau in der Sowjetunion im Zeitraum 1955 bis 1991. Statt auf die Ikonen der Sowjetarchitektur richtet er den Blick auf die Bauten, die für mehr als 170 Millionen Menschen zum Alltagsleben gehörten – und bis heute das Erscheinungsbild vieler Städte zwischen Kaliningrad und Wladiwostok prägen.
Begonnen hatte der Siegeszug der Platte mit Nikita Chruschtschow. Im Dezember 1954 machte er Schluss mit dem Neoklassizismus der Stalin-Ära und leitete einen Paradigmenwechsel im Wohnungsbau ein. Qualität und Kostensenkung waren die Schlagworte seines Bauprogramms, von dem er betonte: »Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es nur einen Weg: die umfassende Industrialisierung des Bauwesens.« Die Aufgabe war immens, schließlich wurde die Wohnungsnot mit dem Tod Josef Stalins noch verschärft, da Millionen ehemaliger Gefangene aus dem Gulag ein Dach über dem Kopf suchten.
Mit seinem ehrgeizigen Programm nahm Chruschtschow den gesamten Wohnungsbau des flächenmäßig größten Landes der Erde in staatliche Hände. Projektinstitute planten die Bauten, Kombinate realisierten sie. Die vier- bis fünfgeschossigen Wohnungsbauten in Großblockbauweise erhielten bei der Bevölkerung den Spitznamen »Chruschtschowki«. Von einer Einheitsplatte kann dabei nicht die Rede sein. Man entwickelte Wohnungsbauserien für verschiedene Klimazonen und Varianten für geologische Sonderfälle wie erdbebengefährdete Regionen. So wurde die Platte sowjetischen Vorbilds auch in anderen Ländern – von Kuba bis Nordkorea – zum Erfolgsmodell. In Mittel- und Osteuropa schuf man eigene Serien nach sowjetischem Muster. Auch in der DDR waren 75 Prozent des Wohnungsbaus industriell vorgefertigt.
Meuser hat für seine Untersuchung Moskau, Leningrad (das heutige Petersburg) und Taschkent als Beispiele ausgewählt. Die zuletzt genannte Stadt spielt eine Sonderrolle, da sie 1966 bei einem Erdbeben schwer beschädigt wurde. Mit der Hilfe von Planern und Baukombinaten aus allen 15 Teilrepubliken wurde sie als sozialistische Musterstadt neu errichtet.
Meuser gliedert sein Buch in drei Teile: Der erste ist den soziokulturellen Verbindungen zwischen den Debatten der frühen Moderne und den Anfängen des industriellen Bauens gewidmet. Im zweiten Teil stehen die bautechnischen und gebäudekundlichen Entwicklungen von Chruschtschow bis zum Ende der Sowjetunion im Mittelpunkt. Hier geht es um den Modernisierungsschub in den 1950er Jahren, der die Grundlage für das größte Wohnungsbauprogramm der modernen Architekturgeschichte war. Im dritten Teil widmet er sich der Definition von typologischen und funktionellen Parametern zur Identifikation serieller Wohnungsbautypen und wendet diese am Beispiel der drei Städte an.
Dem Charakter einer wissenschaftlichen Arbeit ist geschuldet, dass die Texte für Nichtfachleute teils sperrig geschrieben sind und es mitunter auch zu kleineren Redundanzen kommt. Dennoch ist das Buch (allein schon durch sein Fotomaterial) nicht nur für Architekten und Bauhistoriker interessant, sondern für alle, die einen intensiveren Blick in ein bedeutendes Stück Alltagshistorie des 20. Jahrhunderts werfen wollen.
Philipp Meuser: Die Ästhetik der Platte. Wohnungsbau in der Sowjetunion zwischen Stalin und Glasnost. DOM Publishers, Berlin 2015, 728 Seiten, 98 Euro
Veröffentlicht in: Junge Welt, Feuilleton, 7.1.2016
Galina Balaschowa – die Weltraumarchitektin
Kaum jemand kennt Galina Balaschowa, obwohl sie Geschichte schrieb. Als Architektin – und einzige Frau weit und breit – prägte sie gleich fünf Weltraum-Missionen der Sowjetunion entscheidend mit. Der Verlag DOM publishers aus Köln widmete ihrem einzigartigen Schaffen nun ein Buch.
Gemütlichkeit gehört nicht unbedingt zu den Attributen, die man Raumschiffen oder Raumstationen zuschreiben würde. Eher denkt man an viel Technik und wenig Platz – und das alles unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit. Doch die Architektin Galina Balaschowa, bis vor wenigen Jahren noch in ihrer russischen Heimat wie auch im Ausland gänzlich unbekannt, sorgte über viele Jahre hinweg dafür, dass sowjetische Kosmonauten ein wenig Behaglichkeit im All fanden. 26 Jahre lang entwickelte sie gemeinsam mit ihren männlichen Ingenieurkollegen Weltraumkapseln,- fähren und -stationen und sorgte dafür, dass nicht nur reine Funktionalität, sondern tatsächlich auch so etwas wie ein „Wohlfühlfaktor“ deren Innenraumgestaltung mit bestimmte.
Dabei hatte nichts bei ihrem Abschluss als Absolventin des Instituts für Architektur in Moskau im Jahr 1955 darauf hingedeutet, dass sie später den Fokus auf das All richten würde. Allein ihre Hochzeit mit ihrem Studienkollegen, dem Physiker Juri Balaschow, sorgte dafür, dass die junge Architektin ihm 1957 zum OKB-1, dem geheimen sowjetischen Weltraumprogramm, nach Koroljov folgte. Auch Balaschowa durfte dort mitarbeiten, allerdings zunächst mit fester Bodenhaftung: Behausungen für die Mitarbeiter und deren Familien standen bei ihr auf dem Programm.
Doch nach dem Weltraumflug von Juri Gagarin 1961 begann man mit der Planung für weitere bemannte Flüge und auf der Suche nach Gestaltungsideen trat man schließlich an die Architektin heran. Balaschowa machte sich an einem Wochenende ans Werk und fertigte die ersten Skizzen und Pläne, die sie dann zu den für sie typischen dreidimensionalen Aquarellen ausarbeitete.
Ihre Arbeiten fanden Gefallen, denn sie verstand es darin, die Anforderungen der Technik mit einem ausgewogenen, menschlichen Design zu verbinden. „Das ist die Aufgabe des Architekten: die Raumkapsel gemütlich zu machen“, meinte Balaschowa selbst dazu.
Architektur für die Kosmonautik wurde ab 1963 so zu ihrem Spezialgebiet, bei dem sie fast alles, was das Fachgebiet bislang für sie ausmachte – so etwa ein festes Fundament – über Bord werfen musste. Doch es gelang ihr, die speziellen Gegebenheiten einer Architektur ohne ein festes Oben und Unten und angesichts eines Interieurs, das sich mitsamt den Bewohnern in der Schwerelosigkeit gerne selbständig macht, bei ihren Planungen adäquat umzusetzen. So sorgte sie etwa mit unterschiedlichen Materialien sowie einem einfachen, aber ausgeklügelten Farbeschema dafür, dass sich bei den Kosmonauten ein Gefühl für Boden (grün), Wände (gelb/cremefarben)und Decke (grau) einstellen konnte.
Auch ein Sofa fand dank Balaschowa im Wohnbereich, dem sogenannten „Salon“ der Sojus seinen Platz, auf dem die Kosmonauten nach anfänglichen Schwierigkeiten dank Klettstreifen an den Hosen
tatsächlich sitzen konnten. Großen Wert legte sie bei ihrer Arbeit darauf, die Erfahrungen und Anregungen der Kosmonauten zu berücksichtigen, um weitere Verbesserungen zu realisieren: „Wie sonst
hätte ich meine Entwürfe optimieren können?“
So ist sie auch heute noch stolz darauf, wie neidisch die US-Astronauten waren, als sie zum ersten Mal zur ISS kamen. „Die Apollo war eher technisch-funktional eingerichtet, sie hatte nicht einmal
einen Salon … Bei den Amerikanern hat sich wahrscheinlich keine Frau mit der Innenarchitektur beschäftigt“. Dennoch profitierten auch die amerikanischen Astronauten indirekt von ihrem Können,
entsprechen Cockpit und Wohnbereich der ISS doch weitgehend ihrem Entwurf für die MIR, sodass ihr Farbkonzept dort bis heute seine Anwendung findet.
Allein das Problem, sich mehr auf einem Staubsauger sitzend als auf einer Toilette zu fühlen, über das sich die Besatzungen nach ihren Reisen beklagten, konnte Balaschowa zu ihrem Verdruss trotz aller Bemühungen nur minimieren, jedoch nie gänzlich beheben…
Aber nicht nur die Gestaltung der erfolgreichen Projekte wie Woschod, Sojus, MIR oder Buran oblag Balaschowas planerischem Geist. Auch das Design des Mondschiffs der Sowjetunion, das nach erfolgreicher Mondlandung der NASA auf Eis gelegt wurde, entsprang ihrer Feder – oder besser gesagt, ihrem Wasserfarbkasten. Balaschowa blieb ihrem Prinzip treu, ihre Entwürfe nach ersten Skizzen als Aquarelle umzusetzen. Deren Originale unterlagen strikter Geheimhaltung, ebenso wie das Design für die Medaillen und Briefmarken des Apollo-Sojus-Gemeinschaftsprojekts 1975.
So arbeitete Balaschowa mehr als zweieinhalb Jahrzehnte, ohne dass die Öffentlichkeit Notiz von ihr nahm, noch dazu für einen kargen Lohn. Während die männlichen Ingenieure regelmäßig Gehaltserhöhungen bekamen, verharrte die Architektin trotz ihrer prominenten Funktion auf derselben Gehaltsstufe. Allein ihrem Nebenerwerb, der Aquarellmalerei, verdankte sie ein einträgliches Auskommen – und auch heute noch malt die seit 1990 im Ruhestand lebende alte Dame, um ihr Einkommen aufzubessern. Dennoch hat sich keine Frustration bei ihr breit gemacht – im Gegenteil: „Ich liebe meinen Beruf, an dem mich das Streben nach Harmonie und dem richtigen Maß fasziniert. Kurz gesagt, das Weltall hat mich nie so gereizt wie die Architektur“, so das Fazit der mittlerweile 84jährigen.
Dass nun die Weltöffentlichkeit späte Notiz von ihr genommen hat, ist dem Umstand zu verdanken, dass sie seit der Pensionierung offen über ihre Arbeit sprechen darf. Und auch die Ausstellung
„Outer Space“, die bis Februar dieses Jahres in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen war, hatte Anteil daran, dort präsentierte man erstmalig einem internaztionalen Publikum von ihr vor Ort
handkolorierte Entwurfszeichnungen.
Der Verlag Dom publishers in Köln widmete ihr nun eine wunderbar gestaltete Monografie in goldenem Softcover, die umfassend über ihr Leben und ihre Arbeit berichtet und mit mehr als 180 farbigen
Abbildungen ihrer Aquarelle aufwartet. Ein interessantes und kurzweiliges Lesevergnügen – nicht nur für Weltraumfans und architektonisch Interessierte, sondern für alle, die ein Interesse an
ungewöhnlichen Biografien haben.
Philipp Meuser (Hg.): Galina Balaschowa. Architektin des sowjetischen Raumfahrtprogramms
Band 33 der Reihe Grundlagen, 160 S., 189 Abb., ISBN 978-3-86922-345-2, Oktober 2014, 28,00 Euro
Der Artikel wurde, leicht gekürzt, am 15.05.2015 in der Jugen Welt veröffentlicht.
Hier finden Sie mich
Monascript
Mona Grosche
Wachsbleiche 29
53111 Bonn
Kontakt
Rufen Sie einfach an +49 228 2809642 oder nutzen Sie das Kontaktformular.