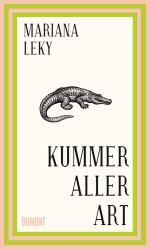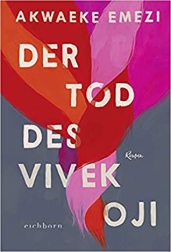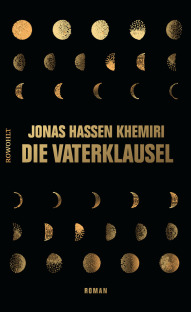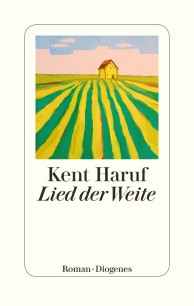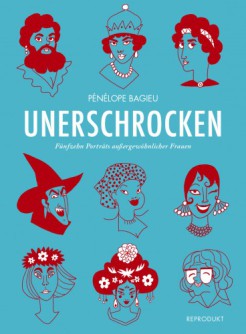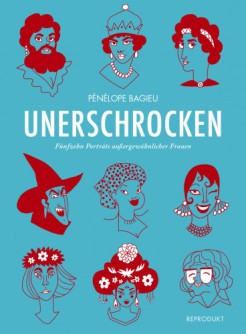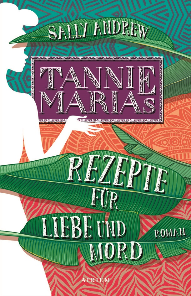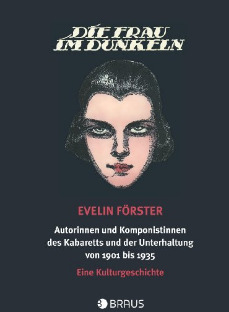KLeinstadtdrama
Wer eine Ahnung davon bekommen möchte, wie es in den USA fernab großer Städte zugeht, sollte einen Blick in die Romane von Kent Haruf werfen. Wie kaum ein anderer verstand es der 2014 verstorbene Autor, sensible Geschichten zu erzählen, die von großen Themen wie Liebe, Freundschaft und Solidarität, aber auch von Betrug, Missgunst und Gewalt handeln. Auf der Bühne einer fiktiven Kleinstadt in Colorado führt er menschliche Dramen auf, die großen Tragödien in nichts nachstehen. Auch in „Ein Sohn der Stadt“, dem jüngsten auf Deutsch vorliegenden Titel, findet man sich in der kleinen Präriestadt Holt wieder, die mit Diner, Mainstreet und Farmen ringsum wie aus der Zeit gefallen wirkt. Doch dort ist längst nicht alles so harmlos wie es scheint. So sehen sich die Einwohner – einschließlich des Ich-Erzählers, dem Herausgeber der Lokalzeitung – plötzlich mit einer Person konfrontiert, der sie lieber nie wieder begegnet wären: Jack Burdette ist in seinen Geburtsort zurückgekehrt, nachdem er vor 8 Jahren nicht nur einige Einwohner um eine große Summe Geldes erleichterte, sondern auch seine schwangere Frau mit 2 kleinen Söhnen sitzenließ. Dementsprechend wandert Burdette sofort in die Zelle des lokalen Polizeireviers. In Rückblicken erfahren wir von seinem Leben, das davon geprägt war, Menschen einzuschüchtern und zugleich mit seinem Charme eine Menge Mitläufer um sich zu scharen. Mit seiner Durchtriebenheit kam er nicht nur durch die Highschool, sondern auch zu einem lukrativen Posten, den er zu einem skrupellosen Betrug nutzte…
Unprätentiös und lakonisch erzählt der Roman von den Abgründen menschlichen Verhaltens und
ist, für sich genommen, ein großartiges, lesenswertes Buch. Wer aber Harufs andere Werke kennt, wird etwas enttäuscht, denn hier erreicht er noch nicht die
Meisterschaft, die er in den späteren Romanen zeigt. Für Haruf-Neulinge bietet es aber den idealen Einstieg in sein Schaffen, das leider durch seinen Tod nach 6 Romanen endete.
Kent Haruf (Ü: pociao, Roberto de Hollanda): Ein Sohn der Stadt, Diogenes 2021, 288 S., 24 EUR
Schnüss Stadtmagazin 2022
Literatur als Seelenwärmer
Leider nicht auf Rezept, dafür aber garantiert nebenwirkungsfrei ist ein Stimmungsaufheller besonderer Art, nämlich
Mariana Lekys ›Kummer aller Art‹. Der Erzählband umfasst 13 literarische Kolumnen, die für das Magazin ›Psychologie heute‹ entstanden sind, nun aber
für das Buch noch einmal überarbeitet wurden. Der schmale Band sei jedem dringend ans Herz gelegt, der gerade eines kleinen oder großen Trostpflasters bedarf. In den Texten kämpfen sich sowohl die
Ich-Erzählerin als auch deren Familie, ihre Freunde und nicht zuletzt ihre Nachbarn durch das Alltagsleben. Dessen Kümmernissen und Widrigkeiten trotzen sie mal mehr und mal weniger erfolgreich, denn
Ängste jedweder Couleur, Liebesnot, Schlaflosigkeit oder auch Probleme mit dem Altwerden machen ihnen zu schaffen.
Leky betrachtet ihre Figuren mit einem liebevollen, einfühlsamen Blick, der von einem tiefen Verständnis für die Unbilde des menschlichen Daseins zeugt. Egal ob der ängstebeladene Herr Pohl und seine
Pinscherdame Lori, Frau Wiese, die von der Liebe eiskalt erwischt wird oder aber Onkel Ulrich, der von Rückenschmerzen geplagt wird. Bei ihnen vermittelt uns Leky mit großer Herzenswärme, sensible
Einblicke in die menschliche Natur. Auf grandiose Weise versteht sie es, stilistische Leichtigkeit mit inhaltlichem Tiefgang zu verbinden, sodass man manchmal laut lachen, weinen oder „ja genau“
schreien möchte. Dabei gelingen ihr Sätze und Metaphern, die zum Niederknien schön sind, wie der von Schwester Gertrud im Krankenhaus, die Ulrich darüber
aufklärt,
Keine andere Autorin bringt es fertig, einem die Angst eines zitternden Pinschers glaubhaft als „Superkraft“ zu verkaufen. Vielleicht gerade deshalb fühlt man sich ihren Figuren sehr nah und zugleich
in seinem eigenen Kummer auf wundersame Weise gesehen, ernstgenommen und getröstet. Mehr kann man von einem Buch nicht wollen.
Mariana Leky: Kummer aller Art. DuMont, 2022, 172 S. 22 EUR
Schnüss Stadtmagazin 2022
David gegen Goliath
Imbolo Mbues Roman »Wie schön wir waren« zeigt ein afrikanisches Dorf im Kampf gegen
einen Ölmulti
Kosawa ist ein fiktives Dorf in Westafrika, doch weltweit gibt es viele Dörfer wie dieses: Ausgebeutet von internationalen
Konzernen mit Hilfe korrupter einheimischer Machthaber, wird alles aus dem Land herausgepresst, was es an Schätzen birgt. Woanders sind es seltene Erden, Gold, Zucker und Soja, weshalb die
Lebensgrundlagen der Menschen vor Ort zerstört werden. In Kosawa ist es das Öl. Die Bewohner haben das Land einst von ihren Vorfahren übernommen, die es ihrerseits der Legende nach als Geschenk von
einem Leoparden erhielten. Seither leben sie von der Jagd und vom Ackerbau. Was übrig ist, verkaufen sie in der nächsten Stadt auf dem Markt und finanzieren damit, was sie darüber hinaus
brauchen.
Das althergebrachte Leben nimmt jedoch in den 1980er Jahren ein schleichendes Ende, als der us-amerikanische Konzern Pexton mit der Ölförderung in Kosawa beginnt. Das Projekt, das von „seiner
Exzellenz“, dem skrupellosen Diktator des Landes, genehmigt wurde, soll den Bewohnern – die natürlich niemand um ihre Erlaubnis gefragt hat – angeblich Wohlstand und eine rosige Zukunft bringen. Doch
allein der Dorfvorsteher und seine Familie profitieren davon und ziehen in ein Steinhaus mit westlichem Mobiliar. Der Rest geht leer aus. Und schlimmer noch: Die Ölpipeline verseucht den Boden, der
Fluss versinkt unter einer stinkenden Müllschicht. Sogar die Luft ist durch ungefilterte Abgase verschmutzt.
Immer mehr Menschen in Kosawa, vor allem Kinder, leiden an unerklärlichen Krankheiten, mit denen die dörflichen Schamanen meist überfordert sind. Angesichts von immer neuen Todesopfern ist den
Dorfbewohnern klar, dass die Ölförderung sie geradewegs ins Unheil geführt hat. Verzweifelt ergreifen sie Maßnahmen, um Hilfe von den Behörden zu bekommen und sich gegen den Konzern zur Wehr zu
setzen. Doch alle Versuche bringen nur noch mehr Tote und noch mehr Leid über Kosawa. Allein der Kontakt zu Austin, einem Journalisten, weckt neue Hoffnung, denn er bringt die Ereignisse in die
amerikanischen Medien, sodass sich eine dortige Menschenrechtsorganisation für Kosawa einsetzt. Sie sorgt für erste Entschädigungszahlungen sowie für mehr Bildung der Dorfkinder. Zwar kommt Letztere
fast ausschließlich den Jungen zugute. Doch zumindest ein Mädchen, die Protagonistin Thula, erhält ebenfalls die Chance auf eine höhere Schulbildung. Später bringt sie sogar ein Stipendium als
Einzige zum Studium nach New York. Dort trifft sie erstmals auf andere Menschen, die ähnliches erfahren haben wie sie und für eine Veränderung der Verhältnisse kämpfen. Dabei setzen sie allerdings
eher auf Revolution als auf Evolution…
Mit »Wie schön wir waren« legt Imbolo Mbue nach ihrem mit dem PEN/Faulkner-Preis prämierten Debüt »Das geträumte Land« nun erneut einen Roman vor, der ihre großen Erzählkunst unter Beweis stellt.
Anklage und Elegie zugleich, schildert der Roman eindringlich die Skrupellosigkeit, mit der multinationale Konzerne ihre Profitgier über menschliche Bedürfnisse stellen und dabei alte koloniale
Abhängigkeiten Hand in Hand mit einheimischen Machthabern fortführen.
Die Darstellung ist jedoch weder schematisch noch plakativ, auch wenn Kosawa symbolisch für viele Orte dieser Welt stehen kann. Bei dem gezeigten Kampf David gegen Goliath versteht Mbue es, alle ihre
Figuren als echte Menschen darzustellen. Mit viel Empathie und Feingefühl haucht Mbue Protagonisten wie Nebenfiguren mit ihren jeweiligen Bedürfnissen, Wünschen und Nöten Leben ein und lässt die
Lesenden an deren Entwicklung Anteil nehmen. So präsentiert sie nicht nur die Dorfbewohner als komplexe Charaktere, sondern auch die Helfershelfer des Konzerns, die glauben, sich unbeschadet am Elend
der anderen bereichern zu können. Gerade dies lässt die Geschichte realistisch und glaubwürdig wirken – und trägt zur Aufrechterhaltung des Spannungsbogens des durchaus langen Werks bei.
Dafür, dass dieser nicht abreißt, sorgen zudem stete Wechsel in der Perspektive der über mehrere Jahrzehnte hinweg erzählten Geschichte. Thula selbst kommt verschiedene Male zu Wort, aber wir
erfahren auch die innersten Gedanken ihrer Mutter, ihrer Großmutter, ihres verstorbenen Vaters, ihres Onkel und ihres kleinen Bruders. Ebenso lernen wir die Sichtweise der anderen Kinder des Dorfes
kennen. Als kollektives „Wir“ berichten sie zunächst gemeinsam, bis sie schließlich als Erwachsene für sich alleine sprechen, da sie uneinig sind, wie der Kampf gegen den Ölkonzern zu gewinnen
wäre.
Auch wenn natürlich der ungleiche Kampf im Zentrum des Romans steht, ist er nicht das alleinige Thema. Mbue gibt tiefe Einblicke in ein archaisch anmutendes Leben, das von alten Traditionen und engen
familiären Bindungen geprägt ist. Doch dies wird nicht als Idyll konstruiert. Ohne romantisierende Verklärung erzählt sie vom Glauben an den großen Geist, von schamanischen Ritualen, von Riten rund
um Geburt, Erwachsenenwerden und Tod. Es wird nachfühlbar, das dies alles einerseits zwar Heimat und Halt bietet, aber andererseits Beschränkungen in der Entfaltung eigener Lebensziele und Träume
auferlegt. Innerhalb der patriarchalen Dorfstruktur trifft dies insbesondere – aber nicht nur – auf die Mädchen und Frauen zu. Ein wütender, trauriger Roman von enormer erzählerischer
Kraft.
Imbolo Mbue (übersetzt von Maria Hummitzsch): Wie schön wir waren, Kiepenheuer & Witsch 2021, 448 Seiten, 978-3-462-05470-5, 23 EUR
Literaturkritik 2022
Die Fassade durchbrechen
Nigeria: Ein Junge stirbt, weil er seine Sexualität offen auslebt. Ein Roman über Zwänge, Religion und eine widerständige junge Generation
Bereits auf der ersten Seite des Romans »Der Tod des Vivek Oji« trifft es den Lesenden wie ein Faustschlag: Eines
Nachmittags findet Vivek Ojis Mutter den Leichnam ihres Sohnes auf der Veranda des Hauses. Wie ein in Stoff gewickeltes Paket hat jemand den leblosen Körper mit eingeschlagenem Schädel dort abgelegt.
Verzweifelt versucht sie herauszufinden, warum ihr einziges Kind sterben musste. Ist er den Unruhen zum Opfer gefallen, die auf dem Markt der kleinen Stadt im Süden Nigerias ausgebrochen waren? Doch
wer brachte ihn nach Hause – und wieso nackt in Stoff gewickelt? Diese Fragen gehen ihr nicht mehr aus dem Sinn, und sie beginnt auf eigene Faust nachzuforschen, was die Hintergründe seines Todes
sein könnten.
Vivek, dessen Geburt vom Tod der Großmutter überschattet wurde, ist schon von Kindheit an eher ein Außenseiter, der unter seltsamen Anfällen leidet. Außerdem ist er schüchtern und in sich gekehrt. Die Mutter reagiert darauf mit Fürsorge und Hätschelei, während der Vater hofft, dass der Militärdienst aus ihm einen »richtigen Mann« machen wird. Beiden gemeinsam ist, dass ihnen Vivek mit seinem Verhalten fremd ist. Sie schämen sich für ihn und versuchen, ihn den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechend zu formen. Das will aber einfach nicht gelingen, so schläft er lieber auf einem Baum als in seinem Zimmer und weigert sich, seine Haare schneiden zu lassen. Alle Versuche, ihn zu »kurieren«, fruchten nicht. Letztendlich führen diese – insbesondere der gewaltsame »Exorzismus« in der Freikirche seiner Tante – nur dazu, dass er sich noch weiter in sich zurückzieht.
Verständnis und Zuneigung findet Vivek allein bei Cousin Osita und vier Schulfreundinnen, die er von klein auf kennt. Ebenso wie seine indischstämmige Mutter sind auch deren Mütter »Niger Wives«, also Frauen aus dem Ausland, die mit nigerianischen Männern verheiratet sind. In den Ehen herrscht reine Routine statt ein wirkliches Miteinander – wenn nicht gar Schlimmeres droht, wie etwa der Einzug einer Zweitfrau ins gemeinsame Heim, weil diese einen »Stammhalter« geboren hat …
Akwaeke Emezi zeichnet die Eltern als in den Zwängen von Traditionen, gesellschaftlichen Erwartungen und religiösem Eifer gefangen. So versuchen die Figuren dieser Generation vor allem, den äußeren Schein zu wahren, denn sie können ihre wahren Bedürfnisse und Träume nicht formulieren oder gar umsetzen.
Ganz anders wird die junge Generation um Vivek und sein befreundetes Umfeld dargestellt. Die Jugendlichen sehnen sich nach einem freien Leben, in dem sie ihre Identität und ihre Sexualität ausleben können, ohne sich verstecken zu müssen. Das ist aber im Vielvölkerstaat Nigeria, wo in zwölf Landesteilen die islamische Scharia herrscht, ein Tabu. Auch im Süden des Landes ist Homosexualität öffentlich geächtet. Wer sich outet, läuft Gefahr, von einer aufgebrachten Menge gelyncht zu werden. Um diese Gefahr wissen die jungen Leute, weshalb auch die Freundinnen Juju und Elisabeth nur im geheimen ein Liebespaar sein können.
Doch Vivek möchte mit dem Leben hinter einer Fassade brechen und seine Persönlichkeit und Gefühle auch nach außen hin zeigen – bis zu seinem tragischen Ende. Wie dies in Wahrheit aussah, weiß nur einer der Protagonisten des Romans, so dass man beim Lesen bis zur Auflösung auf den letzten Seiten mitfiebert, was wirklich geschehen ist und warum Vivek sterben musste.
Aus der Sichtweise der unterschiedlichen Protagonisten erzählt, entwickelt Akwaeke Emezi, die sich selbst als nichtbinäre multiple Persönlichkeit sieht, hier eine mitreißende, tiefgründige Story um sexuelle Identitäten und persönlichen Freiheitswillen. Dabei wird auch der politisch-kulturelle Hintergrund Nigerias beleuchtet und wirkt mit in die Handlung hinein, trotzdem könnte die Geschichte – wie jedes echte Drama – auch sonst überall auf der Welt stattfinden. Stilistisch präzise und feinfühlig zeichnet Akwaeke Emezi vielschichtige Persönlichkeiten, die nach der Lektüre lange in Erinnerung bleiben.
Akwaeke Emezi (Übersetzung: Anabelle Assaf): Der Tod
des Vivek Oji. Eichborn Verlag. Frankfurt am Main 2021, 271 Seiten, 22 Euro
Junge Welt 13.08.2021
Schrecken im Familienidyll
Hanno kehrt zurück in die Kleinstadt, die er vor knapp 30 Jahren verließ. Doch nicht die Sehnsucht nach einem Wiedersehen führt ihn in den Ort seiner Kindheit zurück. Vielmehr ist es der Tod der Mutter, die sich allein um den zunehmend senilen chronisch kranken Vater gekümmert hatte – oder vielmehr nicht ganz allein, gibt es da immer noch Lupus, den Hund, der aus ihrer Sicht absichtlich ihren Tod herbeiführte.
Doch nicht nur Lupus hat sie die ganze Zeit begleitet: Heimlich verfolgte Susanne, die Tochter der verstorbenen Nachbarn, nach einer Geburtstagsfeier im Sommer 1986 bis hin zu Hannos Rückkehr das Leben der Familie Holtz minutiös mit dem Fernglas.
Nun bietet sie Hanno Hilfe bei der Betreuung des Vaters an. Schließlich sind die beiden gemeinsam aufgewachsen und kannten sich gut. Gerne nimmt Hanno ihre Unterstützung an, denn ihn zwingt allein sein Pflichtgefühl, sich um den Vater zu kümmern. So entspannt sich ein seltsames Dreiecksverhältnis zwischen Herrn Holtz, Hanno und Susanne, bei dem alte Erinnerungen wieder hochkommen. Am Ende wird klar, was vor Jahrzehnten die heile Welt der Nachbarn zerstört hat und warum keiner der Beteiligten je den Mut fand, darüber zu sprechen…
Auch wenn der etwas spröde Beginn des Romans es nicht vermuten lässt, wartet Andreas Moster hier mit einer sensiblen,
spannungsreichen Geschichte auf, in deren Mittelpunkt patriarchale Machtstrukturen in scheinbar heilen Familien stehen. Erzählt wird dies aus verschiedenen Blickwinkeln: So kommen nicht nur Hanno und
Susanne, sondern auch Hannos verstorbene Mutter zu Wort. Die unterschiedlichen Erzählperspektiven und die beiden Zeitebenen, auf denen die Protagonisten agieren, sorgen dafür, dass erst nach und nach
ein collagenartiges Gesamtbild der Hintergründe jahrzehntelangen hilflosen Schweigens entsteht. Zum Glück endet dies nicht in Düsternis und Depression, stattdessen erwartet die Lesenden ein
fulminanter Schluss in Form eines Befreiungsschlags.
Andreas Moster: Kleine Paläste, Arche August 2021, 22
EUR
Schnüss 9/2021
Amerikanischer Alptraum
Jessup ist 17 und lebt in der Kleinstadt Cortaca in Upstate New York, die schon bessere Tage gesehen hat. Allein die
renommierte Uni sorgt dafür, dass die Stadt nicht vor die Hunde geht. Doch Leute wie Jessup haben nichts davon, denn er gehört zum so genannten „White Trash“. Seine Familie lebt im Trailer Park und
hält sich mühsam über Wasser. Vor diesem Hintergrund wundert es wenig, dass er tagtäglich am eigenen Leib erlebt, dass der „amerikanische Traum nichts für jedermann ist, sondern eine Art
Geburtsrecht“.
So muss er trotz seiner Intelligenz mühsam um gute Noten kämpfen. Schuld daran ist auch das Stigma, aus einer „Nazi-Familie“ zu stammen. Sein Bruder und sein Stiefvater, die beide in der „Heiligen
Kirche des Weißen Amerika“ aktiv sind, sitzen wegen eines Tötungsdelikts an zwei schwarzen Studenten im Knast. Dennoch hofft Jessup, dass alles besser wird, denn er hat Aussichten auf ein Stipendium
und eine heimliche Freundin: Deanne, die Tochter seines schwarzen Footballcoaches. Aber genau der Tag, an dem der Stiefvater heimkommt, wird für ihn zum Wendepunkt. Nach einem Spiel wird er bei einer
Party in den tödlichen Unfall eines schwarzen Spielers der Gegenmannschaft verwickelt. Überzeugt, dass keiner an seine Unschuld glaubt, beschließt er, das Geschehen zu vertuschen und setzt eine Kette
fataler Ereignisse in Gang...
Alexi Zentner wuchs selbst in Upstate New York auf, wo Neonazis zwei Brandanschläge auf das Haus seiner Eltern - beide Aktivisten gegen Rassismus und Antisemitismus - verübten. Mit
„Eine Farbe zwischen Liebe und Hass“ verarbeitet er das Erlebte literarisch und
versetzt sich sensibel in einen Menschen, der „auf der anderen Seite“ groß geworden ist. Sprachlich versiert erzählt, entwickelt der Roman von Beginn an ein mitreißendes Tempo, das den Leser in den
Bann zieht. Zentner ist damit eine sensible Coming-of-Age-Geschichte und eine treffende Kritik an dem undurchlässigen Gesellschaftsmodell der USA gelungen.
Alexi Zentner: Eine Farbe zwischen Liebe und Hass, Suhrkamp 2020, 376 S. 18 Euro
Schnüss Stadtmagazin Oktober 2020
schwierge Familienbande
Obwohl er in Schweden zu den meistgelesenen
Autoren gehört, ist Jonas Hassen Khemiri hierzulande noch nicht sonderlich bekannt. Das ändert sich hoffentlich mit dem Roman „Die Vaterklausel“, in dem er erneut unter Beweis stellt, dass er ein
meisterlicher Beobachter menschlicher Beziehungen, insbesondere derer in Familien, ist. In ›Vaterklausel‹ dreht sich alles um eine Familie mit Migrationshintergrund. Der Vater, inzwischen mehrfacher
Großvater, hat vor vielen Jahren die Familie zurückgelassen, um wieder in der Heimat zu leben. Warum, weiß man nicht genau, vermutlich aber, um dort dank regelmäßiger Aufenthalte in Schweden seine
dubiosen Import-Export-Geschäfte unter günstigen Steuerbedingungen fortzuführen. So zumindest lautet die nüchterne Analyse seiner Tochter, die sich keine Illusionen über ihn macht. Oft genug hat er
unter Beweis gestellt, dass in seinem Leben nur eine Person von Bedeutung ist – er selbst. Dennoch bemüht sie sich stets, ebenso wie ihr Bruder, es ihm recht zu machen. Stundenlang kochen sie
Abendessen, zu denen er nicht erscheint, holen ihn zu Unzeiten am Flughafen ab, weil er nicht Bus fahren will – und der Bruder räumt jedes Mal sein Büro, damit der Vater dort während seines
Aufenthaltes wohnen kann. Schließlich gehörte das zur „Vaterklausel“, die er einging, um nach dessen Wegzug die Einzimmerwohnung übernehmen zu dürfen. Doch diesmal ist alles anders: Der Sohn,
inzwischen selbst zweifacher Vater, ist es leid, seine Pflicht zu erfüllen, während die Schwester dank einer ungewollten Schwangerschaft mit anderen Problemen kämpft. - Und schließlich mischt sich
auch noch die verstorbene Halbschwester aus dem Jenseits ins Geschehen ein…
In sprachlich pointierter Erzählweise und mit einem guten Schuss Ironie zeichnet Khemiri in wechselnden Perspektiven das komplizierte Gefühlsleben seiner Protagonisten nach, von denen man hofft, dass
sie trotz allem doch noch einen Weg zueinander finden.
Jonas Hassen Khemiri: Die Vaterklausel, Rowohlt 2020, 336 S., 24 Euro
Schnüss Stadtmagazin Bonn 2020
Die Heimat reist mit
Dina Nayeris jüngster
Roman erzählt intelligent und gefühlvoll vom Leben in der Fremde
Man wünschte, es gäbe mehr Bücher wie dieses. Und man wünschte, dass die Menschen voller Hass und Hochmut gegenüber Flüchtenden doch einmal so ein Buch lesen würden… Utopisch, natürlich. Aber Wünsche
sind ja unzerstörbar, auch wenn sie unerfüllbar sind.
Das weiß auch Nilou, die Protagonistin in „Drei sind ein Dorf“, nur allzu gut. Nilou musste, ebenso wie die Autorin Dina Nayeri selbst, als Kind aus dem Iran in die USA fliehen. Doch in Gedanken
wünscht sie sich das unbeschwerte Leben in Isfahan zurück, wo „Baba“ immer eine Handvoll getrocknete Sauerkirschen oder eine Geschichte für die kleine Tochter bereithielt, wenn er aus seiner
Zahnarztpraxis nach Hause kam. Ebenso lieb sind ihr die Erinnerungen an die Wochenendausflüge nach Ardestun, ins Dorf der Großmutter, die alljährlich eine neue Spezialmischung aus regionalen Gewürzen
und Kräutern zaubert, die bis heute den Geschmack der Heimat in ihr Essen zaubert.
Doch es gibt weder für Nilou noch für sonst wen einen Weg zurück ins heile Familienleben. Der Vater hatte das Versprechen, „irgendwann“ Frau und Kindern zu folgen, nicht gehalten. Vielmehr ging der
opiumsüchtige Hedonist und Lyrikfreund noch zwei unglückliche Ehen ein und hat seither seine ihm fremd gewordenen Kinder nur auf wenigen kurzen Reisen im Ausland getroffen. Sie haben zwar gute Jobs
und einen sicheren Aufenthaltsstatus im Westen, doch tief im Innern ist vor allem Nilou zerrissen und heimatlos. Diese Erfahrung bleibt auch ihrem Vater nicht erspart, denn als ihn das Regime unter
Hausarrest stellt, ist auch seine Zeit gekommen, um das Land für immer zu verlassen. Und so macht er sich auf nach Amsterdam, wo Nilou in den Scherben ihrer Ehe sitzt…
Auch wenn der Roman vor dem Hintergrund des zunehmenden Rassismus und des erstarkten Populismus in den Niederlanden spielt und die Situation der iranischen Flüchtlinge dort eindringlich schildert,
zielt er in erster Linie nicht darauf ab, die Missstände der europäischen Asylpolitik zu dokumentieren. Vielmehr widmet sich die poetisch erzählte Familiengeschichte den vielen unterschiedlichen
Aspekten von Flucht und Exil, von Heimat und Fremdsein, wie sie nur ein sensibler Umgang mit den eigenen Erfahrungen und Emotionen offenlegen kann. – So etwa die herzzerreißende Sequenz, wo Nilou
ihre „Parzelle“ – eine Ecke in der Wohnung mit den wichtigsten Habseligkeiten – vor ihrem Ehemann Gui vehement verteidigt und ihn damit zutiefst verstört und verletzt.
Ebenso wie Nayeris erster auf Deutsch erschienene Roman „Ein Teelöffel Land und Meer“ ist diese autobiografisch gefärbte Geschichte eine ebenso intelligente wie mitreißende Lektüre, die auf weitere
Romane der Autorin hoffen lässt.
Dina Nayeri: "Drei sind ein Dorf", Mare 2018,
368 S., 24 EUR
Veröffentlicht in: Libertäre Buchseiten, Frankfurter Buchmesse 2018
Große Gefühle in der Provinz
Kent Harufs „Lied der Weite“ ist ein fröhlich-melancholisches Lesevergnügen
Was für ein Glück, dass der Diogenes Verlag den amerikanischen Autor Kent Haruf nun auch dem deutschsprachigen Publikum näher bringt! Wie bereits der Roman Unsere Seelen bei Nacht, der 2017 auf Deutsch erschien, beweist nun auch Lied der Weite: Haruf war eine bedeutende Stimme in der nordamerikanischen Literatur – und es ist ein Jammer, dass er im Jahr 2014 bereits verstorben ist.
Doch auch wenn Lied der Weite (auf Englisch Plainsong) 1999 auf der Shortlist des National Book Award stand und in den USA zum Bestseller avancierte, wurde Haruf erst mit seinem
letzten Roman Unsere Seelen bei Nacht wirklich berühmt, der 2015 posthum veröffentlicht und 2017 mit Jane Fonda und Robert Redford verfilmt wurde. Diesem Erfolg ist es wohl auch geschuldet,
dass Haruf, dessen Romane teilweise früher auf Deutsch vorlagen, nun hierzulande noch einmal neu entdeckt wird.
Dabei wirkt sein Werk zunächst wenig spektakulär, schließlich bewegen sich seine Geschichten meist in der fiktiven Kleinstadt Holt in den Prärien Colorados; seine Protagonisten sind Viehzüchter, Landärzte, Highschool-Kids, Lehrer und alte einsame Damen. Auch was sie zwischen Güterzuggleisen, Farmen und Feldern erleben, ist auf den ersten Blick alles andere als „großes Kino“. Und wer schon einmal im ländlichen Nordamerika unterwegs war, sieht die verschlafene Kleinstadt geradezu vor sich, an deren Hauptstraße sich Frisör, Kino und der unvermeidliche Diner als Zentren des sozialen Lebens aneinanderreihen.
Doch Haruf vermag es, ganz leise, ganz lakonisch, an diesem Schauplatz die Erkenntnis zu vermitteln, dass es so etwas wie ein kleines oder langweiliges Leben nicht gibt. Gerade die „einfachen“ Leute, die er zu den Protagonisten seiner Romane auserkoren hat, erleben wie im griechischen Drama die Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins mit voller Wucht. Da prallen Liebe und Hass, Einsamkeit und Sehnsucht nach Nähe, Aggression und menschliche Güte so unmittelbar aufeinander, dass es der großen Bühne in nichts nachsteht.
So auch in diesem Roman, in dessen Zentrum die 17-jährige Schülerin Victoria steht. Sie ist ungewollt schwanger und wird deshalb von ihrer Mutter kurzerhand vor die Tür gesetzt. Zum Glück nimmt ihre Lehrerin Maggie Jones sie bei sich auf. Doch Maggies dementer Vater reagiert aggressiv auf ihre Anwesenheit und so muss eine neue Lösung her: Ausgerechnet die McPheron-Brüder, die weit draußen auf einem alten Gehöft als einsame Junggesellen Kühe züchten, bittet die Lehrerin um Unterstützung. Nach anfänglichem Zögern willigen die menschenscheuen Eigenbrötler in das Experiment ein. Victoria zieht bei ihnen ein und das ungewöhnliche Trio gewöhnt sich an das Leben miteinander, bis dann unverhofft Victorias Freund wieder auftaucht.
Jedoch nicht nur Victoria sieht sich mit großen Problemen konfrontiert. In der Familie von Lehrer Tom Guthrie ist auch nichts mehr, wie es früher einmal war: Seine Frau leidet unter Depressionen und zieht in ein eigenes Haus. Aber zum großen Kummer und Unverständnis der beiden Söhne Ike und Bobby bleibt es nicht dabei. Vielmehr geht sie, vermutlich für immer, nach Denver zu ihrer Schwester. Vater Tom hat jedoch nicht nur alle Hände voll zu tun, seinen Söhnen die Mutter zu ersetzten, sondern auch Stress an der Highschool, wo ihm ein aufsässiger, tumber Gewalttäter das Leben erschwert und auch vor Attacken auf seine Kinder nicht Halt macht. Schließlich hält auch noch die Liebe, die sich mit seiner Frau aus seinem Leben verabschiedet zu haben schien, über Umwege in der Person von Maggie wieder Einzug bei dem Lehrer.
In wechselnden Perspektiven lässt uns Haruf an den Gefühlen der Protagonisten teilhaben – wobei auch die Nebenfiguren mit wenigen Pinselstrichen überzeugend gezeichnet sind. Es gehört zu der besonderen Gabe des Autors, dass man sich beim Lesen weniger als Betrachter von außen denn als Einwohner der kleinen Stadt und ihrer umliegenden Farmen fühlt, so vertraut ist man bereits nach wenigen Seiten mit den Menschen und der Szenerie.
Doch wer glaubt, hier in eine heile Traumwelt versetzt zu werden, wo – wie dereinst bei den Waltons im Fernsehen – spätestens beim Gutenachtgruß alles wieder in Ordnung ist, irrt sich. Auch auf dem Land ist bei Weitem nicht alles idyllisch oder wird am Ende wieder gut. Schlimme Demütigungen und tiefe Verletzungen, wie von der Mutter vor die Tür gesetzt zu werden oder vom Freund zum Sex „ausgeliehen“ zu werden, sind ebenso präsent wie tiefe Trauer, wenn das eigene Pferd qualvoll zugrunde geht oder eine alte Dame einsam und alleine in ihrem Sessel stirbt.
Das alles erzählt Haruf zart und leise, aber präzise beobachtend. Ohne Action oder Knalleffekte und auch ohne jede Rührseligkeit zeigt er mit seinem klaren Stil, wie einfach es eigentlich ist, als
Mensch zu innerer Größe zu gelangen. Aber er verschweigt keineswegs, dass dies ein Kraftakt ist, der manchen einfach nicht gelingen mag. Großartige Literatur, die melancholisch und froh zugleich
macht.
Kent Haruf: Lied der Weite. Roman.
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Rudolf Hermstein.
Diogenes Verlag, Zürich 2018.
377 Seiten, 24,00 EUR.
ISBN-13: 9783257070170
Erschienen 2018 auf www.literaturkritik.de
Unerschrocken
Humorvolle Frauenporträts in Comicform
Gleich 15 eigensinnige, starke und in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Frauen aus aller Welt sind in dem neuen Comicband
von Pénélope Bagieu versammelt, der nun auch auf Deutsch vorliegt. Dabei ist es Bagieu gelungen, ebenso geistreich und witzig wie auch lehrreich über das Leben der Frauen zu berichten, die
in unterschiedlichen Jahrhunderten gesellschaftlichen Zwängen mit Mut und Eigensinn entgegentraten.
Dabei sind in dem schön gestalteten Band neben bekannten Persönlichkeiten wie die Künstlerin Josephine Baker oder die Erschafferin der „Mumins“, Tove Jansson auch weniger bekannte Frauen versammelt,
die es allesamt wert sind, dass man sie nicht vergisst. So etwa die Schwestern Mirabal, die unter dem Decknamen Las Mariposas gegen den Diktator der Dominikanischen Republik, Rafael Trujillo, aktiv waren und 1960 hingerichtet wurden.
Oder aber Margaret Hamilton aus Ohio, die nichts sehnlicher wünschte, als Schauspielerin zu werden. Beim Vorsprechen hatte sie jedoch nie Erfolg, da sie den gängigen Schönheitsidealen nicht
entsprach. Erst als sie sich Nebenrollen wie böse Stiefschwester und Hexe verschrieb, wendete sich das Blatt, sodass sie schließlich die Rolle der Hexe des
Westens im Filmklassiker „Der Zauberer von Oz“ erhielt. Die brachte
ihr nicht nur erhebliche körperliche Blessuren ein – so ließ sich die grüne Farbe im Gesicht für lange Zeit nicht entfernen und sie erlitt Verbrennungen – sondern auch internationalen
Ruhm.
Nahezu unbekannt ist heute die Gynäkologin Agnodike, die im antiken Athen lebte: Sie stellte fest, dass viele Gebärende bei
der Geburt starben, seitdem Frauen der Arztbesuch untersagt worden war, aus Angst, sie könnten Abtreibungen vornehmen. Männliche Ärzte lehnten die Frauen bei der Geburt jedoch ab. So studierte
Agnodike Medizin in Ägypten und praktizierte, als Mann verkleidet, so erfolgreich in ihrer Heimat, dass ihre Kollegen sie aus Neid des Missbrauchs anklagten. Als sie daraufhin ihre wahre
Identität preisgab, wollte man sie erst recht zum Tod verurteilen. Doch der Protest der Frauen mit der Drohung, ihre Männer zu verlassen, verhinderte das nicht nur, sondern sorgte auch dafür, dass
die Gesetze gegen weibliche Ärzte abgeschafft wurden.
Wohin man blickt, finden sich in diesem Buch Kämpfernaturen, die mal auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, mal
„nur“ in ihrem Umfeld für Selbstbestimmung stritten: So etwa Josephine van Gorkum, die trotz strikter Trennung von Katholiken und Protestanten in den Niederlanden eine gemischtkonfessionelle Ehe
führte. Das verkomplizierte nicht nur das Familienleben durch getrennte Krankenhäuser, Schulen, Geschäfte, sondern wirkte über den Tod hinaus. Doch selbst da fanden sie und ihr Mann einen Weg, den
Konventionen zu trotzen: Noch heute reichen sie sich von ihren Grabmalen aus über die Mauer hinweg, die den Friedhof teilt, die steinernen Hände.
Aber egal ob Wirtin, Kaiserin, Entdeckerin, Sozialarbeiterin, Tänzerin oder Apachenkriegerin – sie alle haben mit persönlichem Mut, Willen und Stärke dazu beigetragen, dass das Leben von Frauen heutzutage ein gutes Stück freier und leichter ist. Sie sind hervorragende Vorbilder für uns und unsere Töchter, es ihnen gleichzutun und für das einzustehen, woran wir glauben und wovon wir träumen.
Pénélope Bagieu: Unerschrocken. Fünfzehn Porträts
außergewöhnlicher Frauen, (Ü: Heike Drescher u. Claudia Sandberg), ISBN 978-3-95640-129-9, 144 S., Reprodukt Oktober 2017, 24 EUR
Erschienen in: Junge Welt 2017
Humorvolle Frauenporträts in Comicform
Gleich 15 eigensinnige, starke und in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Frauen aus aller Welt sind in dem neuen Comicband
von Pénélope Bagieu versammelt, der nun auch auf Deutsch vorliegt. Dabei ist es Bagieu gelungen, ebenso geistreich und witzig wie auch lehrreich über das Leben der Frauen zu berichten, die
in unterschiedlichen Jahrhunderten gesellschaftlichen Zwängen mit Mut und Eigensinn entgegentraten.
Dabei sind in dem schön gestalteten Band neben bekannten Persönlichkeiten wie die Künstlerin Josephine Baker oder die Erschafferin der „Mumins“, Tove Jansson auch weniger bekannte Frauen versammelt,
die es allesamt wert sind, dass man sie nicht vergisst. So etwa die Schwestern Mirabal, die unter dem Decknamen Las Mariposas gegen den Diktator der Dominikanischen Republik, Rafael Trujillo, aktiv waren und 1960 hingerichtet wurden.
Oder aber Margaret Hamilton aus Ohio, die nichts sehnlicher wünschte, als Schauspielerin zu werden. Beim Vorsprechen hatte sie jedoch nie Erfolg, da sie den gängigen Schönheitsidealen nicht
entsprach. Erst als sie sich Nebenrollen wie böse Stiefschwester und Hexe verschrieb, wendete sich das Blatt, sodass sie schließlich die Rolle der Hexe des
Westens im Filmklassiker „Der Zauberer von Oz“ erhielt. Die brachte
ihr nicht nur erhebliche körperliche Blessuren ein – so ließ sich die grüne Farbe im Gesicht für lange Zeit nicht entfernen und sie erlitt Verbrennungen – sondern auch internationalen
Ruhm.
Nahezu unbekannt ist heute die Gynäkologin Agnodike, die im antiken Athen lebte: Sie stellte fest, dass viele Gebärende bei
der Geburt starben, seitdem Frauen der Arztbesuch untersagt worden war, aus Angst, sie könnten Abtreibungen vornehmen. Männliche Ärzte lehnten die Frauen bei der Geburt jedoch ab. So studierte
Agnodike Medizin in Ägypten und praktizierte, als Mann verkleidet, so erfolgreich in ihrer Heimat, dass ihre Kollegen sie aus Neid des Missbrauchs anklagten. Als sie daraufhin ihre wahre
Identität preisgab, wollte man sie erst recht zum Tod verurteilen. Doch der Protest der Frauen mit der Drohung, ihre Männer zu verlassen, verhinderte das nicht nur, sondern sorgte auch dafür, dass
die Gesetze gegen weibliche Ärzte abgeschafft wurden.
Wohin man blickt, finden sich in diesem Buch Kämpfernaturen, die mal auf politischer und gesellschaftlicher Ebene, mal
„nur“ in ihrem Umfeld für Selbstbestimmung stritten: So etwa Josephine van Gorkum, die trotz strikter Trennung von Katholiken und Protestanten in den Niederlanden eine gemischtkonfessionelle Ehe
führte. Das verkomplizierte nicht nur das Familienleben durch getrennte Krankenhäuser, Schulen, Geschäfte, sondern wirkte über den Tod hinaus. Doch selbst da fanden sie und ihr Mann einen Weg, den
Konventionen zu trotzen: Noch heute reichen sie sich von ihren Grabmalen aus über die Mauer hinweg, die den Friedhof teilt, die steinernen Hände.
Aber egal ob Wirtin, Kaiserin, Entdeckerin, Sozialarbeiterin, Tänzerin oder Apachenkriegerin – sie alle haben mit persönlichem Mut, Willen und Stärke dazu beigetragen, dass das Leben von Frauen heutzutage ein gutes Stück freier und leichter ist. Sie sind hervorragende Vorbilder für uns und unsere Töchter, es ihnen gleichzutun und für das einzustehen, woran wir glauben und wovon wir träumen.
Pénélope Bagieu: Unerschrocken. Fünfzehn Porträts
außergewöhnlicher Frauen, (Ü: Heike Drescher u. Claudia Sandberg), ISBN 978-3-95640-129-9, 144 S., Reprodukt Oktober 2017, 24 EUR
Erschienen in: Junge Welt 2017
Amerikanisches Kleinstadtleben
Es gibt Bücher, die hinterlassen eine gewisse Trauer, wenn man sie nach der letzten Zeile weglegt. Dazu gehört auch „Ein Mann der Tat“ von Richard Russo. Denn dieser großartige Roman ist so unaufgeregt und dennoch spannend, so herzergreifend anrührend und dabei so selbstironisch, dass es einem schwerfällt, sich etwas vorzustellen, was man danach wohl als Nächstes lesen mag.
Das ist keineswegs eine untypische Reaktion, wenn es sich um ein Buch des begnadeten Autors Russo handelt, der in den letzten Jahren endlich auch hierzulande bekannt
wurde. Dabei hätte es das deutschsprachige Publikum verdient, dass man ihm diesen Lesegenuss wesentlich früher bescherte, schließlich hatte er bereits 2002 für „Empire Falls" den Pulitzer Preis
bekommen, das dann 2016 unter dem Titel "Diese gottverdammten Träume" endlich auf Deutsch vorlag. Nun hat der Dumont Buchverlag mit "Ein Mann der Tat" auch eine deutsche Fassung von Russos Roman
„Everybody’s fool“ vorgelegt. Wer sein Werk bereits kennt, trifft auf eine Schar alter Bekannter, handelt es sich sich um die Fortsetzung von „Nobody’s Fool“, das 1994 mit Paul Newman in der
Hauptrolle verfilmt wurde.
Doch auch wem das Städtchen North Barth in Upstate New York und seine Bewohner noch gänzlich unbekannt sind, merkt schon nach den ersten Seiten, dass er sie hier ganz genau kennenlernen wird – vielleicht sogar mehr als ihm lieb ist, da Russo sich gerne viel Zeit beim Erzählen lässt. So dreht sich der aktuelle Roman ausschließlich um die Ereignisse rund ums Memorial Day Wochenende – und derer gibt es viele, wie der rund 700 Seiten dicke Wälzer beweist. Denn auch wenn es sich bei North Bath um eine Kleinstadt auf der Verliererseite handelt – ganz im Gegensatz zum Nachbarort Schuyler Springs – und auch seine Bewohner nicht gerade erfolgreiche Lebensläufe vorzuweisen haben. Dass hier nichts los wäre, kann nur wirklich niemand behaupten, der ein wenig näher hinsieht – und das tut Russo, mit Wonne. Detailverliebt, mit spöttischem Unterton, aber auch mit viel Empathie lässt er uns an den Ereignissen aus dem Leben seiner Antihelden teilhaben, die bereits in Nobody’s Fool versuchten, irgendwie mit den alltäglichen Widrigkeiten klarzukommen.
Da ist mal wieder Donald Sullivan, „Sully“, spürbar gealtert und von Krankheit gezeichnet, der dennoch nichts lieber tut, als sich in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Rub, sein stotternder Kumpel, der es am liebsten hat, wenn alles so bleibt wie es ist, aber dringend einen Ast vom Baum absägen muss, was ihm eine arge Misere einbringt. Carl, dessen Prostataprobleme ein Klacks neben seinem eingestürzten Investitionsobjekt sind. – Oder auch Polizeichef Douglas Raymer, der nicht nur ohnmächtig in ein offenes Grab sinkt, sondern auch noch u.a. mit einer Giftschlange und der Frage, wer der Liebhaber seiner verstorbenen Frau war, beschäftigt ist…
So erfahren wir in 33 teilweise heiteren, teilweise eher düsteren Kapiteln aus Sicht unterschiedlicher Personen alles über die enormen Probleme, mit denen die
Protagonisten zu kämpfen haben. Dies geschieht bei aller Ausführlichkeit mit psychologisch scharfsinnigem Blick und einer guten Prise schwarzen Humors, ohne dass die skurrilen Begebenheiten je ins
Slapstickhafte abgleiten. Vielmehr erweist sich Russo als präziser und hellsichtiger Beobachter menschlicher Beziehungen generell – und der so genannten „kleinen Leute“ im Besonderen. Atemlos
verfolgt man als Leser das Geschehen und hofft, dass am Ende zumindest ein paar Figuren doch noch die Kurve kriegen und ihrem Leben eine Wende zum Besseren geben.
Richard Russo (Ü: Monika Köpfer): Ein Mann der Tat, Dumont 2017, 688 S., ISBN: 978-3-8321-9824-4, 24,99 €
Gekürzte Fassung erschienen in Schnüss Stadtmagazin Bonn"
Schmerzhafte Reise zu sich selbst
Sweetness schämt sich für die dunkle Haut ihrer Tochter. Dass sie diese Lula Ann – Hauptfigur des neuen Romans von Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison – geboren hat, will sie nicht wahrhaben. »Sie war so schwarz, dass sie mir Angst machte. Mitternachtsschwarz, sudanesisch schwarz.« Das sind ihre Worte – und zugleich die ersten Sätze von »Gott, hilf dem Kind«, in den USA 2014 erschienen und jetzt bei Rowohlt in der Übersetzung von Thomas Piltz.
»In meiner Familie gibt es niemanden, der auch nur annähernd diese Farbe hat«, klagt die Mutter: »Teer ist der beste Vergleich, der mir einfällt … Man könnte sie für einen Rückfall halten, aber wohin?«
Sweetness glaubt, dass maximale Assimilation eine Chance ist, möglichst wenig mit
Rassismus und Ausgrenzung konfrontiert zu werden. Das Kind macht all ihre Hoffnungen, als Weiße durchzugehen, zunichte. So begegnet sie der Tochter mit Grausamkeit und Strenge. Sie müsse sie auf die Härten des Lebens vorbereiten, rechtfertigt sie ihr Verhalten. Körperliche Nähe erfährt das Mädchen nur in Form von Schlägen – die sie provoziert, um von der Mutter überhaupt wahrgenommen zu werden.
Doch diese Lula Ann Bridewell ist stark. Und so schüttelt sie mit ihrem alten Namen zumindest äußerlich ihre Vergangenheit ab. Sie geht nach New York, trägt auf Anraten eines Typberaters nur noch reines Weiß, das ihre »lakritzfarbene Schönheit« erstrahlen lässt, und nennt sich »Bride«. Das einstige Stigma wird zum »Kapital«, das sie strategisch einsetzt, um in der Kosmetikbranche prompt für Furore zu sorgen. Doch trotz Luxusleben mit Penthouse und Jaguar lassen sich die Schatten der Vergangenheit nicht abschütteln. Und sie hat ein dunkles Geheimnis: Sie hat eine Frau fälschlich des Kindesmissbrauchs bezichtigt und ins Gefängnis gebracht. Ihr scheinbar geregeltes Leben gerät aus den Fugen, als ihr Geliebter Booker sie verlässt und obendrein die damals Verurteilte aus der Haft entlassen wird. »Bride« wird immer mehr zur kleinen, ängstlichen Lula Ann und versucht, ihre Schuld wiedergutzumachen, was jedoch im Desaster endet. Schließlich macht sie sich auf die Suche, um zu erfahren, warum Booker fortging – und ob ihre Liebe nicht doch noch zu retten ist.
Nicht nur die Protagonistin selbst, auch Booker und andere Nebenfiguren sind zutiefst verletzte, beschädigte Seelen. Vor allem das Thema Missbrauch zieht sich wie ein roter Faden durch den Roman. Vor dem Hintergrund von Armut, rassistischer Ausgrenzung und zerstörerischer Aggression untereinander wirken die Schilderungen der Missbrauchserfahrungen realistisch. Obwohl diese finsteren Episoden aus dem Leben der Nebenfiguren meist nur kurz angerissen werden, wird der Roman phasenweise durch die schier unerträgliche Menge an Leid so düster, dass man das Buch gern weglegen würde.
Am Ende entwickelt sich das Ganze zu einer Reise in die eigene Kindheit, einem befreienden Reinigungsprozess – und einem tatsächlichen Trip durch die ländlichen Regionen der USA. Bride und Booker sind am Ende wieder vereint – und bereit, das Leben zusammen zu meistern und dem Kind, das sie erwarten, eine bessere Zukunft zu gestalten.
Das mutet reichlich märchenhaft an, aber man nimmt das bei einer so großartigen Autorin gern in Kauf. Zumal bei Morrison generell auch surreale Elemente zum Tragen kommen. So vollzieht sich Brides Entwicklung zurück zum wehrlosen Kind nicht nur metaphorisch, sondern auch körperlich: Ohrlöcher, Schamhaare, Brüste verschwinden allmählich, und erst nach der seelischen Genesung tritt sie äußerlich wieder als erwachsene Frau in Erscheinung.
Vieles wird in dem raffiniert erzählten Roman nur angerissen. Doch trotz der Knappheit, mitunter sogar Kargheit der Darstellung gelingt Morrison eine überzeugende, kraftvolle Schilderung dessen, was Gewalt und Angst aus Menschen machen – und wie eng Opfer- und Täterrolle mitunter verbunden sind.
Toni Morrison: Gott, hilf dem Kind. Rowohlt Verlag, Hamburg 2017, 209 Seiten, 19,95
Euro
Junge Welt 14.08.2017
Vom Glück der Normalität
Stephan Lohse erzählt vom Umgang mit Verlust und Trauer, spürt aber auch einer Kindheit
in den 1970ern nach.
Hamburg im Sommer 1972. Der elfjährige Benjamin lebt mit Mutter Ruth und dem kleinen Bruder Jonas in einem Vorort, während der Vater mit seiner neuen Frau nach Frankfurt gezogen ist. Ben und Jonas
vertreiben sich hier an Sommernachmittagen die Zeit, wie es Kinder in den 1970ern eben tun: Sie spielen im Garten des Reihenhauses, fahren mit den Rädern herum oder gehen ins
Schwimmbad.
Doch genau so ein Freibadnachmittag verändert alles auf einen Schlag: Jonas bekommt mitten im Wettschwimmen einen
Krampfanfall. Zwar sind schnelle Helfer zur Stelle, aber im Krankenhaus fällt er ins Koma und stirbt ein paar Tage später. Für Ben und Ruth beginnt eine schlimme Zeit, beide vermissen den Kleinen
sehr. Da Ruth sich aber beständig weinend auf die Heizdecke im Schlafzimmer zurückzieht und ansonsten versucht, einfach nur zu funktionieren, fühlt sich Ben ziemlich alleingelassen mit seiner
Traurigkeit.
Alleine muss er aber auch mit einer ganzen Menge alterstypischer Ängste und Nöte klarkommen, so etwa den Fragen, ob er cool
genug ist für den neuen Freund Chrisse, wie er mit dem rabiaten Rüpel bei den Garagen umgeht, und wie man sich beim ersten Kuss mit einem Mädchen verhält. Viele Dinge in Bens Leben sind noch mit
einem Fragezeichen versehen, umso mehr, als Jonas Tod natürlich neue Fragen aufwirft, wie etwa die, was Gott bloß dazu bewegt, einen Achtjährigen sterben zu lassen oder ob Regenwürmer auch in Gräbern
für gute Belüftung sorgen – und wozu? Viele der Dinge, die Ben insgeheim bewegen, kann er mit Kumpel Chrisse diskutieren. Andere, wie die bange Frage, ob ein Kuss unter Jungs was Schlimmes ist,
blendet er lieber aus. – Oder er summt zur Beruhigung. Das bringt ihm zwar bei Lehrern und Mitschülern den Ruf eines Spinners ein, hilft aber dabei, die Klippen des Alltags zu umschiffen.
Über all das kann er mit seiner Mutter auf keinen Fall reden, denn während es für Ben mit der Zeit ganz langsam wieder bergauf geht, verharrt Ruth in emotionaler Erstarrung. Ihr Sohn versucht, sie
durch Flötenspiel, kluge Unterhaltungen und möglichst gutes Benehmen wieder ins normale Leben zurückzuholen. Doch all das scheint nicht zu fruchten. Sie bleibt trotz kurzer Momente der Freude wie
gelähmt in der schier unerschöpflichen Trauer. Und so reift in ihr der einsame Entschluss heran, für sich selbst und Ben mit alledem Schluss zu machen. Dabei hat sie aber die Rechnung ohne ihren Sohn
gemacht, denn er bringt es schließlich doch noch fertig, ihr zu zeigen, welches Glück es ist, einfach nur am Leben zu sein.
Mit großer Sensibilität gelingt es Stephan Lohse in dem Roman „Ein fauler Gott“, Trauer und Komik in einer ausgefeilten Balance zu halten, die seine Geschichte davor bewahrt, ins Kitschige oder
Melodramatische abzugleiten. Dazu trägt auch bei, dass er uns teilhaben lässt an einer Kindheit/Jugend in den 1970er Jahren, die man förmlich riechen, schmecken und sehen kann, so etwa, wenn die
Kinder mit Delial eingeschmiert werden, Ravioli aus der Dose essen und darüber streiten, ob Flipper oder Bonanza besser sei. Wer die Zeit selbst erlebt hat ist wieder mittendrin und spielt Autofahren
im abgewrackten Opel Rekord, begeistert sich für Mark Spitz und Winnetou und macht „Disco“ mit Juliane Werding und Rex Gildo…
Vor diesem Hintergrund erlebt der Leser aus wechselnder Sicht von Ben und Ruth die Probleme des Heranwachsens ebenso mit wie die des Erwachsenseins. Ein geistreicher, humorvoller Roman mit Tiefgang,
den man nicht aus der Hand legen kann.
Literaturkritik, April 2017
Stephan Lohse: Ein fauler Gott, Suhrkamp 6.3.2017, 336 S., 22,00 € ISBN: 978-3-518-42587-9
Existentialistisches Getier – META BENE
Fragt ein Pinguin den anderen: „Was ist Ihr nächstes berufliches Ziel?“. Und der antwortet: „Freitag“. Oder ein Vögelchen auf einem Ast stellt fest „Selbstdisziplin ist innere Diktatur!“
Cartoons wie diese beiden sind typisch für Robin Thiesmeyer, dessen amüsante Tuschezeichnungen bereits seit 2013 über eine stetig wachsende Fangemeinde im Internet verfügen. Nun liegen die
tiefsinnigen, philosophischen und manchmal auch einfach nur albernen Miniaturen endlich in Buchform vor: Da tummeln sich melancholische Pinguine neben abenteuerlustigen Schnecken, frechen Antilopen
und selbstbewussten Fischen, dass es einfach eine Freude ist. Oft verblüffend, mitunter nachdenklich machend und auf jeden Fall superlustig und herzerwärmend kann man sich unter dem Titel „Es gibt
mehr Sterne als Idioten“ auf über 96 Seiten mit minimalistischen Zeichnungen und Minidialogen/-Monologen rund um Arbeit, Beziehungen und das Leben an sich freuen.
Wer sich erst einmal einen Eindruck verschaffen möchte, kann vorab auf www.metabene.de
vorbeischauen. Doch Achtung: Einmal angefixt, will man auf jeden Fall mehr!
Robin Thiesmeyer + META
BENE: Es gibt mehr Sterne als Idioten, Fischer Verlag 2016, 96 S. 14,99 Euro, ISBN:
978-3-596-03456-7
Schnüss Stadtmagazin bonn, Juli 2016
Tannie Marias Rezepte für Liebe und Mord
Ein Buch wie ein leckerer Schokokuchen – man will einfach nicht aufhören…
Irgendwie klingt „Cosy Krimi“ immer ein bisschen abschätzig. Doch wenn Tannie Maria eine reale Person wäre, würde sie den Begriff wohl durchaus zu würdigen wissen. Denn Tannie Maria ist „cosy“!
Ihr Ziel ist es, den Menschen das Leben ein bisschen schöner, einfacher und schmackhafter zu machen. Die Hauptfigur im Erstlingswerk der südafrikanische Autorin Sally Andrew ist nämlich in der
kleinen Provinzzeitung „Karoo Gazette“ für Rezepte zuständig: Und zwar sowohl für Kochrezepte aus der vielseitigen südafrikanischen Küche wie auch für solche, mit denen man seine zwischenmenschlichen
Beziehungen leichter machen kann. – So erhält jeder, der ihr schreibt, einen guten Ratschlag für ein Problem und gleich die Anleitung zum passenden Essen dazu.
Schließlich kocht, backt und isst Tannie Maria eigentlich immer, wenn sie in ihrem Haus in der südafrikanischen Halbwüste Klein Karoo ist. Da gibt es leckere Koeksisters, Bobotie oder Lammcurry und
schon beim Lesen läuft einem bei der Beschreibung der Zubereitung das Wasser im Munde zusammen. Und wenn Tannie Maria dann auf ihrer schattigen „Stoep“, also der Veranda, sitzt und ihren göttlichen
Schokoladenkuchen verspeist, möchte man nichts lieber, als dort zu sitzen, den Hühnern Mais zuwerfen, den Wildtieren lauschen und den Blick auf die Berge am Horizont schweifen lassen.
Doch auch wenn die Atmosphäre einlädt, sich in Fernweh und Sehnsucht nach gutem Essen zu ergehen, ist die abgelegene Provinz kein heimeliges Paradies, sondern ein Ort mit unterschwelligen Konflikten,
von denen auch Maria selbst nicht verschont bleibt. Schließlich war sie jahrzehntelang in einer lieblosen Ehe mit einem gewalttätigen Mann gefangen und konnte sich, auch durch die strengen
Moralvorstellungen ihrer niederländisch-reformierten Kirchengemeinde, daraus nicht selbst befreien. Nun ist sie zwar Witwe und lebt ein friedliches Leben ohne Prügelattacken. Aber auch als Ratgeberin
der Gazette wird sie mit dem allgegenwärtigen Problem der häuslichen Gewalt konfrontiert. Immerhin wird jede vierte Frau in Südafrika von ihrem Mann verprügelt. So erhält sie den Brief einer
verzweifelten Frau, die sich vor ihrem aggressiven Mann fürchtet und vor ihm fliehen will, um mit ihrer Freundin zusammen zu sein. Auch hier versucht Maria, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen – doch
vergebens: Martine wird ermordet aufgefunden und die Polizei verdächtigt sowohl deren Ehemann Dirk wie auch ihre Freundin Anna.
Dass beide unschuldig sind, wird Tannie Maria und ihrer jungen Kollegin Jessie aus der Redaktion schon bald klar, zumal auch noch ein zweiter Mord passiert. Sie machen sich - zum Unwillen der lokalen
Polizei - auf eigene Faust an die Recherche. Dabei stoßen sie nicht nur auf alltägliche Probleme von Hass, Gewalt und Rassismus und auf Adventisten, die das Ende der Welt erwarten, sondern auch auf
eine ernste Bedrohung der Region mit ihrem diffizilen ökologischen Gleichgewicht durch Fracking. Und so stellt sich die Frage nach dem Mörder und seinem Motiv völlig neu…
Mit viel Liebe zum Detail und großer Empathie für ihre Figuren lässt uns Sally Andrew mit Tannie Maria, Jessie und Chefredakteurin Hattie auf die Pirsch gehen – allesamt patente Frauen aus Südafrika,
die sich trotz Unterschiede in Alter und ethnischer Herkunft ganz wunderbar verstehen. Wunderbar an ihnen ist auch, dass sie nicht wie manche (us-amerikanischen) Krimheldinnen auf Dauerdiät sind und
sich allenfalls von Salat ernähren, sondern Beskuits und Schokokuchen verdrücken und ihnen als Sport genügt, im Garten Unkraut zu jäten. Sie sind auch erfrischender Weise nicht dauernd im Einsatz,
sondern machen auch mal Pause. Und auch die Liebe spielt bei ihnen eine Rolle, die von realistischen Problemen wie Übergewicht, Eifersucht und Erinnerungen an frühere Partner beeinflusst
wird.
Wer also Krimis mag, deren Helden sich wie „normale Menschen“ benehmen, deren Story ohne viel Action und Blut auskommt, und die dabei frei von Kitsch und Sozialromantik noch ein wenig Lokalkolorit aus einer fremden Kultur vermitteln, dem sei Tannie Maria ans Herz gelegt. Übrigens: Einige der Rezepte der Kalorienbomben wie Melktart und Vetkoeken sind hinten zum Nachkochen im Buch versammelt.
Sally Andrew: Tannie Marias Rezepte für Liebe und Mord, Atrium Januar 2016, 480 S. 19,99 Euro
Gekürzte Veröffentlichung in: Junge Welt 31.03.2016
Kleider machen Leute
Barcelona 1952: Zum eucharistischen Weltkongress
erwartet die Stadt für einige Tage 300 Bischöfe und 15.000 Priester aus aller Herren Länder. Endlich mal wieder ein Ereignis, dass Glanz und internationales Flair in das von der Franco-Diktatur
gebeutelte Land bringen wird! Nicht nur die Stadtverwaltung müht sich redlich, die Infrastruktur zu verbessern und alles auf Hochglanz zu bringen. Auch die Gläubigen sind gefragt, denn es gibt
nicht genug Hotelbetten für die Gäste. Natürlich kann da Tante Conchita, dank des Reichtums ihres Mannes die ungekrönte Königin ihres Familienclans, nicht „nein“ sagen und erteilt der Familie genaue
Anweisungen für die Tage als Gastgeber eines „Hochwürden“.
Umso größer ist der Frust, als dann der Gast auftaucht: Bischof Fulgencio Putucás kommt aus einem kleinen mittelamerikanischen Staat und wirkt weder würdevoll noch besonders christlich. Doch es kommt
noch schlimmer: Ein Putsch in seiner Heimat vereitelt die Rückreise – und auch die Kirche kümmert sich nicht um ihn. Also landet er bei Conchitas alkoholkrankem Bruder, wo er in kürzester Zeit
„Fulgencio“ wird, der im Haushalt hilft und auf Sauftour mit dem Gastgeber geht. Schließlich verschwindet er ganz, bis nach Jahren anlässlich eines neuen Staatsstreiches die Rückkehr in sein Land
ansteht. Doch auch das bringt noch einige Überraschungen mit sich...
Das Grundthema von „Der Walfisch“ ist eine wenig überraschende Abwandlung des Motivs „Kleider machen Leute“. Dennoch vermag es Mendoza, einer vergleichsweise einfach gestrickten Geschichte Leben einzuhauchen. Seine feine Ironie bringt Tragik und Komik einträchtig zusammen und so ist dies zwar keines seiner stärksten Werke. Aber auch mit schwächeren Texten ist er besser als der literarische Durchschnitt.
Eduardo Mendoza: Der Walfisch, (Übers. Stefanie Gerhold), Nagel & Kimche 2015, 128 S., 16,90 Euro
Schnüss Stadtmagazin Bonn, Dezember 2015
Die Literatur als Rettung
Kader Abdolah erzählt vom Überleben eines Flüchtlings in der Fremde
Der Protagonist in Kader Abdolahs Erzählung »Die Krähe« wächst im Iran heran, in einer Stadt und einem familiären Umfeld, die von den künstlerischen Traditionen des alten Persien geprägt sind. Doch wirft die Politik bereits früh ihren Schatten über Refiq Foads Leben in Isfahan.
Er wird an jenem Tag im Jahr 1953 geboren, als die CIA gegen den demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Mossadegh putscht und dem Schah wieder zur Macht verhilft.
Der angehende Autor Foad, der seine Texte illegal veröffentlichen muss, sieht die
Notwendigkeit, politisch aktiv zu werden. Doch als die islamische Revolution zum Sieg gelangt, erlebt die an der Sowjetunion orientierte Linke eine herbe Enttäuschung: Das neue Regime verfolgt seine
bisherigen Verbündeten mit ebenso großer Grausamkeit wie zuvor der Schah.
Foad muss ohne seine Familie ins Ausland fliehen. Einsamkeit und Trauer prägen seinen zweijährigen Aufenthalt in der Türkei. Eingezwängt in den Laderaum eines LKWs gelangt er in die Niederlande. Dort
schlägt er sich zunächst mit Fließbandarbeit durch, bis er es schließlich schafft, einen eigenen Kaffeeladen zu eröffnen. Seine alte Passion, das Schreiben, gibt er nicht auf. Er widmet sich der
Lektüre der niederländischen Literatur und fängt schließlich an, in der Sprache seines Gastlandes zu schreiben.
Die Erzählung verdeutlicht, dass Literatur ein Mittel sein kann, um in der Fremde zu überleben.
Der seit vielen Jahren in der Nähe von Amsterdam lebende Exil-Iraner Kader Abdolah schreibt auf niederländisch. In seiner zweiten Heimat ist der Autor ein Bestsellerautor. Sein Name ist ein Pseudonym, das an zwei ermordete Freunde aus dem Iran erinnert.
Kader Abdolah: Die Krähe. Arche Literatur Verlag, Zürich 2015, 127 Seiten, 12 Euro
Junge Welt,13.08.2015
Traumatische KIndheit
Sensible Psychogramme mit erzählerisch kunstvollen Spannungsbögen: Margaret Forster gehört zur Crème de la Crème der britischen Literatur. Auch in ihrem jüngsten Roman steht das Schicksal einer Frau im Mittelpunkt und man hält einen echten „Pageturner“ in Händen – und dass, obwohl die Protagonistin nicht gerade zur Sympathieträgerin taugt.
Es geht um Julia, die als Psychologin mit verhaltensauffälligen Kindern arbeitet. In zahlreichen Episoden erhalten wir Einblick in ihre Arbeit und ihre Gefühlswelt als Erwachsene. Auf einet anderen Erzählebene tauchen wir in Julias Vergangenheit ein, in eine Kindheit, die sie bis heute prägt und in den sozialen Beziehungen außerhalb des Berufes stets scheitern lässt. Schaut man sich ihre Jugend an, wundert dies wenig: Julia wächst bei der frustrierten Mutter heran, die das Leben als Alleinerziehende dadurch zu meistern versucht, dass sie das Verlassenwerden durch den Vater mit Disziplin und Emotionslosigkeit kompensiert.
Die oberste Regel für Julia lautet: Keine Fragen stellen, und schon gar nicht über Gefühle reden. So auch, als ihre Cousine Iris die Achtjährige zu ihrer Brautjungfer macht. Was für Julias Mutter eine lästige Pflicht ist, wirkt wie ein Wendepunkt auf das Mädchen. Doch dieser kommt in Wirklichkeit erst später – und anders als sie denkt.
Während einer heimlichen Ausfahrt kippt ihr der Kinderwagen mit Iris‘ Baby um. Und als das Kind nur wenig darauf ohne ersichtliche Ursache stirbt, fühlt sie sich unendlich schuldig. Julia bleibt aber allein mit dem dunklen Geheimnis. Rat und Hilfe gibt es nicht und so suchen sich die angestauten Emotionen ein Ventil in Gemeinheit und Intrigen. Umso mehr kann sie als Erwachsene ihre kleinen Patienten verstehen und ihnen helfen, während sie selbst trotz psychologischen Fachwissens emotional weitgehend auf der Strecke bleibt.
Margaret Forster: Das dunkle Kind, (übersetzt von Saskia Bontjes van Beek), Arche Literatur Verlag, März 2014, 320 S. 22,95 Euro
Neues Deutschland, 26.03.2015
Zurück ins Licht
Nicht nur Männer wie Hollaender und Reutter prägten das Kabarett von 1901 bis 1935 in Deutschland. Evelin Förster würdigt vergessene Autorinnen und Komponistinnen
Mona Grosche
Frauen mit Bubikopf und laszivem Augenaufschlag, die in kurzen Kleidern
frivole Chansons zum Besten geben: So stellt man sich Künstlerinnen der Kabaretts der »wilden 20er« vor. Doch Frauen standen Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur mit neuem Selbstbewußtsein im
Rampenlicht von Kleinkunstbühnen, Theatern und Filmstudios. Was heute kaum noch jemand weiß: Auch hinter den Kulissen waren sie als Autorinnen und Komponistinnen aktiv.
Daß einige dieser Frauen nun aus dem Dunkel des Vergessens wieder auftauchen, ist der Fleißarbeit der aus Thüringen stammenden Sängerin, Tänzerin und Dozentin Evelin Förster zu verdanken, die in
ihrem Buch »Die Frau im Dunkeln« die Ergebnisse langjähriger intensiver Recherchen zu weiblichen Kulturschaffenden im beginnenden 20. Jahrhundert präsentiert. Unter rund 120 Künstlerinnen, auf die
sie stieß, wählte sie 19 aus, deren Biographien und Werkverzeichnisse den Kern ihres Buches ausmachen.
Darunter finden sich Größen wie Erika Mann, Else Lasker-Schüler oder Valeska Gert, aber auch weniger bekannte Namen wie Marita Gründgens (die kleine Schwester von Gustav Gründgens) oder Senta
Söneland, die seinerzeit als Berlins »urwüchsigste Komikerin« nicht nur Kurt Tucholsky begeisterte. Nicht wegzudenken aus einer solchen »Sammlung« ist Claire Waldoff, die über das neue
Rollenverständnis der Frauen sang: »Wenn ein Mädchen sich zu Hause jarnicht rühren kann, ist sie schlimmer als Napoleon auf Elba dran…«
Doch kaum jemand weiß, daß die berühmte Sängerin mit der Berliner Schnauze die Musik zum Chanson »Das moderne Mädchen« und zu anderen Titeln selbst geschrieben hat. Denn Frauen wurden in den Anfängen
des deutschen Kabaretts fast nur als Interpretinnen wahrgenommen. Feste Rollenmuster der wilhelminischen Zeit verboten es »anständigen« Frauen, an Orten wie diesen zu verweilen – oder gar beim
»Tingeltangel« ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dennoch setzten sich Anfang des 20. Jahrhunderts immer mehr »moderne Mädchen« über tradierte Rollenmuster hinweg und suchten ihr Glück in der
Metropole Berlin.
Wie Waldoff fühlten sich viele »geschaffen für die Stadt«, in der sie aus Konventionen ausbrechen konnten, um am blühenden Kulturleben als Dichterinnen, Komponistinnen, Drehbuchautorinnen
teilzuhaben. Doch selbst im für die Zeit freigeistigen Boheme-Milieu war dies für Frauen nicht einfach, weshalb einige von ihnen männliche oder zumindest zweideutige Pseudonyme nutzten. So etwa Eddy
Beuth. Hinter diesem Namen verbirgt sich Marie Cohn, eine Autorin jüdischer Herkunft. Sie schrieb u.a. Drehbücher für experimentelle Stummfilme und Texte für Chansons – und für die Operette »Die Frau
im Dunkeln« von Rudolf Nelson. Doch trotz ihres männlich klingenden Pseudonyms wurde sie in den zeitgenössischen Kritiken kaum erwähnt.
Förster stieß durch Zufall auf den Namen – und wollte mehr über den oder die geheimnisvolle Eddy wissen. So begann ein wissenschaftliches Großprojekt: Je mehr Förster recherchierte, desto mehr
entdeckte sie an Wissens- und Hörenswertem über Künstlerinnen, deren Schaffen die Nazis gründlich aus dem kulturellen Gedächtnis getilgt hatten. Wie ihre männlichen Kollegen hatten sie ab 1933 ihre
Arbeit einstellen müssen. Viele von ihnen konnten nie wieder an alte Erfolge anknüpfen. Andere emigrierten wie Erika Mann oder wählten wie Eddy Beuth den Freitod. Sie schied 1938 gemeinsam mit ihrer
Schwester aus dem Leben.
Über all diese mutigen, gescheiten und lebensbejahenden Frauen kann man nun in Försters unterhaltsamem Buch mehr erfahren. Reich bebildert und wunderschön mit Plakaten, Zeichnungen und Liedtexten
ausgestattet, bietet es neben den Biographien und Werkverzeichnissen eine lesenswerte Einführung in die Berliner (Kabarett-)Kultur, Kurzbiographien weiterer Künstlerinnen und Künstler sowie ein
Spielstättenverzeichnis des damaligen Berlins.
Dem Engagement der Autorin ist es zu verdanken, daß diese Frauen wieder ein Gesicht bekommen haben und eine wichtige Lücke in der Kulturgeschichte geschlossen wurde. Man darf gespannt sein, was ihr
Forscherinnendrang noch zutage fördern wird. Bereits jetzt bilden ein Hörbuch mit Chansons, eine Notensammlung sowie ein Bühnenprogramm weitere Eckpunkte der Försterschen Arbeit.
Evelin Förster: Die Frau im Dunkeln - Autorinnen und Komponistinnen des Kabaretts und der Unterhaltung von 1901 bis 1935/Eine Kulturgeschichte. Edition Braus, Berlin 2013, 416 Seiten, 34,95 Euro * Mit Textbeiträgen von Anja Köhler und Jörg Engelhardt
Junge Welt, 3.1.2014
Verbannung als Chance
Renato Baretic entführt uns auf eine entlegene Adria-Insel
Mona Grosche
»Zuerst kommt Erstchen, und dann, wenn Sie in Zweitchen anlegen, wartet ein gewisser Toni auf Sie. Er fährt Sie mit einem Boot nach Drittchen!« Niederschmetternder könnte die Botschaft nicht sein,
die der Politiker Siniša an einem öden Regentag erhält. Mit nur vier Taschen seiner Habe soll er zwei Jahre auf der am weitesten von der Küste entfernten Insel Dalmatiens bleiben. Dort gilt es zu
vollbringen, woran bereits sieben Vorgänger in den letzten zehn Jahren scheiterten: lokale Wahlen abhalten und eine Verwaltung errichten.
Bei allem Verdruss kann Siniša die Schuld hierfür nur bei sich selbst suchen. Persönliche Dummheit ließ
ihn zur »Persona non grata« werden, denn ein von ihm produzierter Skandal bescherte seiner Partei hohe Verluste bei den Zagreber Kommunalwahlen.
Die einzige Chance auf ein politisches Comeback ist, den Auftrag zu erfüllen. Kampfbereit tritt er also die Reise auf die Insel in der Überzeugung an, in wenigen Monaten Erfolge vorweisen zu können. Doch bereits auf der schier endlosen Überfahrt gerät er angesichts des unverständlichen Dialekts der Mitreisenden und des Skippers Tonino in erste Zweifel am Gelingen der Mission. Und es kommt noch schlimmer: »Drittchen« verfügt weder über eine telefonische Verbindung zur Außenwelt noch über Internet. Strom wird durch Solarzellen erzeugt, die neuesten elektrischen Geräte schafft man aus dem nahen Italien herbei, das auch den skurrilen Dialekt mit geprägt hat. Die Sprache auf der Insel ist aber auch vom Englischen beeinflusst, leben doch fast nur Menschen dort, die einst als Bergleute in Aus-tralien arbeiteten und nun den Lebensabend in der alten Heimat verbringen.
An jüngeren Männern gibt es Tonino, der auch als Übersetzer fungiert, sowie den Bosnier Samir, der sich vor der Mafia versteckt. Die einzige junge Frau ist Zehra, eine bosnische Porno-Darstellerin.
Doch egal ob jung oder alt, keiner will etwas mit der Korruption und den politischen Intrigen des Festlands zu tun haben, führt man doch ein unabhängiges, idyllisches Leben. Auch Siniša lernt
zunehmend die Abgeschiedenheit zu schätzen und erkennt die wichtigen Dinge des Lebens …
Bereits auf den ersten Seiten zieht Renato Baretić den Leser mit der heiter-satirischen Sprache des Romans »Der achte Beauftragte« in seinen Bann. Alida Bremer hat sie hervorragend ins Deutsche gebracht. Mit fünf Preisen ausgezeichnet begründete der Roman die literarische Karriere Renato Baretićs in Kroatien, wo er seit 2003 zu den beliebtesten zeitgenössischen Autoren gehört.
Es verwundert nicht, dass mehrere seiner Werke zu Bestsellern wurden, da er scheinbar mühelos ernste gesellschaftliche Probleme in ironisch-augenzwinkernde Geschichten fasst, die mit ihren starken
Charakteren und intelligenten Wendungen ein ungetrübtes Lesevergnügen bereiten.
Renato Baretić: Der achte Beauftragte. Roman. A. d. Kroat. v. Alida Bremer. Dittrich. 320 S., geb., 19,80 €.
URL: http://www.neues-deutschland.de/artikel/815547.verbannung-als-chance.html
Neues Deutschland, 13.3.2013
Verkaufte Bräute
Mona Grosche
Ein ganz besonderes Buch ist der Roman ›Wovon wir träumten‹ der amerikanischen Autorin Julie Otsuka. Darin erzählt sie die Geschichte der japanischen Frauen, die 1919 als »Picture Brides« in die USA kamen, um dort zu heiraten. Die Männer, die ihnen dort ein besseres Leben versprochen haben, kennen sie nur von Fotos. Dennoch machen sie sich auf den weiten Weg, um in einer Welt zu leben, wie sie kaum fremder sein konnte.
Doch schon bei der Ankunft erleben sie eine herbe Enttäuschung. Die Fotos waren alte Aufnahmen und die vorgeblichen angesehenen Geschäftsmänner entpuppen sich als Wanderarbeiter, Farmer oder Gärtner. Doch den Frauen bleibt nur, sich ins Schicksal zu fügen, denn schlimmer noch wäre die Rückkehr in Schande. Gewohnt nicht aufzubegehren, machen sie sich mit Zähigkeit daran, ihr Leben zu meistern. Sie schuften auf den Feldern, arbeiten als Hausmädchen und gebären Kinder, die sich zusehends zu Amerikanern entwickeln. Als sie glauben, endlich angekommen zu sein, geschieht Unfassbares: Mit dem Angriff auf Pearl Harbor geraten alle Japaner ins Visier der Behörden und verschwinden in Internierungslager…
Zartfühlend und wohlkomponiert kommt Otsukas kleines Büchlein daher, für das sie 2012 den PEN/Faulkner Award erhielt. Darin gelingt ihr die Meisterleistung, allen üblichen Erzähltechniken zum Trotz: Sie erzählt kein Einzelschicksal, es gibt keine Protagonistinnen. Vielmehr lässt sie die Frauen gemeinsam in „Wir“-Form von ihrem Schicksal erzählen. Dass sie dabei nicht zu einer gesichtslosen Masse verkommen, sondern in ihrer Individualität beleuchtet werden, ist der erzählerischen Virtuosität der Autorin zu verdanken. So packt einen dieses leise Buch vom ersten Satz an mit Szenen voller Wut, Trauer, Hoffnung und Freude. Ein intensives Leseerlebnis, das es in seiner Tiefe mit Steinbecks ؓ›Früchten des Zorns‹ aufnimmt.
Julie Otsuka: Wovon wir träumten, Mare 2012,978-3866481794, 18 Euro
Schnüss Stadtmagazin Bonn, Februar 2013
Hier finden Sie mich
Monascript
Mona Grosche
Wachsbleiche 29
53111 Bonn
Kontakt
Rufen Sie einfach an +49 228 2809642 oder nutzen Sie das Kontaktformular.